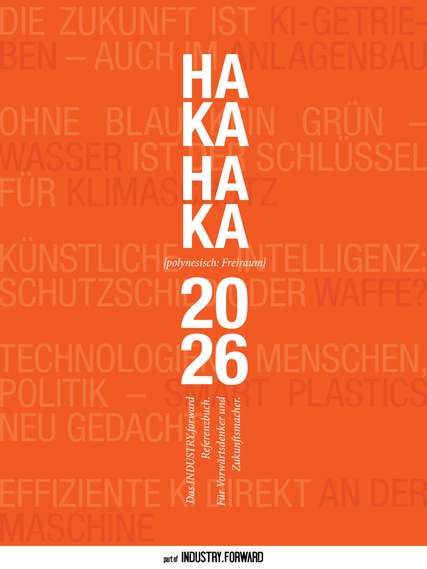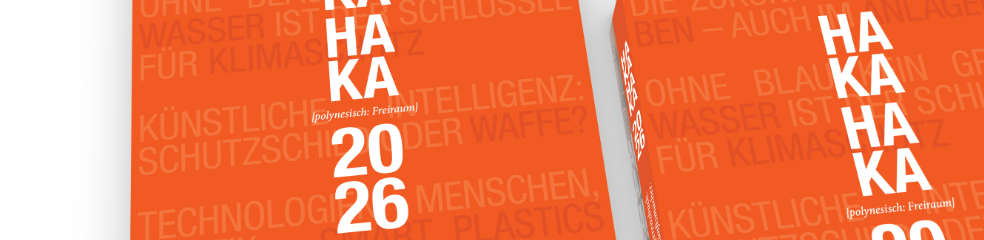Die fortschreitende Energiewende bringt immer größere Anteile volatiler Wind- und Solarenergie ins Netz. Um Angebot und Nachfrage in Balance zu halten, sind flexible Lösungen gefragt – allen voran Batteriespeicher. Viele europäische Länder schaffen bereits regulatorische Erleichterungen, die Investitionen in Batteriespeicher begünstigen. In Deutschland sind Batteriespeicher mittlerweile ein fester Bestandteil des Stromsystems, und ihre Bedeutung wächst kontinuierlich. Studien prognostizieren bis zum Jahr 2030 einen Bedarf von mehreren Dutzend Gigawatt an neuer Flexibilitätskapazität – ein beträchtlicher Anteil dieser Kapazitäten soll durch intelligente Batteriespeicher gedeckt werden.
Trotz positiver Trends bestehen weiterhin Herausforderungen. So wird etwa noch über die Höhe von Netzanschlusskosten (Baukostenzuschuss) und über Genehmigungsverfahren für Batteriespeicher diskutiert – beispielsweise beim Bau von Großspeichern im Außenbereich.
Batteriespeicher als strategische Säule
Als Energieversorger im deutschsprachigen Raum hat Verbund früh die strategische Bedeutung von Batteriespeichern erkannt. Das Unternehmen betreibt aktuell 15 Batteriespeicher-Anlagen in Deutschland und Österreich mit einer Gesamtleistung von rund 110 MW und einer Speicherkapazität von etwa 130 MWh. Weitere Projekte mit mehreren hundert MWh Speichervolumen befinden sich in Umsetzung.
Verbund ist damit seit 2020 als Betreiber von Großbatteriespeichern aktiv und baut sein Portfolio kontinuierlich aus. Batteriespeicher werden vom Management als langfristige Säule der Unternehmensstrategie betrachtet – bis 2030 plant Verbund, Speicher mit einer Gesamtleistung von etwa 1 GW in Österreich und Deutschland zu installieren, um den künftigen Flexibilitätsbedarf zu decken.
Batteriespeicher im Einsatz
Batteriespeicher lassen sich in vielfältigen Anwendungsfällen einsetzen. Grob lassen sich drei Hauptfelder unterscheiden: erstens der Einsatz im Bereich Elektromobilität, zweitens in der Industrie und drittens als netzdienliche Großspeicher für Energieversorger.
Im Bereich Elektromobilität können Batteriespeicher zum Beispiel extreme Lastspitzen an Schnellladestationen abfangen, um lokale Netzanschlüsse zu entlasten. Industrieunternehmen nutzen Batteriespeicher, um Verbrauchsspitzen zu kappen (Peak Shaving) und so Leistungsentgelte zu reduzieren – etwa im Rahmen der „7.000-Stunden-Regel“ der Netzentgeltverordnung, die bei gleichmäßigem Strombezug Vergünstigungen bietet. Zudem ermöglichen Speicher Industriebetrieben, überschüssigen Solarstrom vor Ort zwischenzuspeichern und ihren Eigenverbrauch zu optimieren.
Im Utility-Scale-Bereich, also auf Ebene der Energieversorger und Netzbetreiber, werden große Batteriespeicher direkt ans Netz angeschlossen (Front-of-the-Meter), um Regelenergie bereitzustellen, Strompreis-Arbitrage zu betreiben und Netzdienstleistungen zu erbringen. Solche Großspeicher fungieren als eigenständige Flexibilitätsressource für das Stromsystem.
Mit Batteriespeichern zum Markterfolg
Damit ein Batteriespeicher wirtschaftlich betrieben werden kann, muss er optimal vermarktet und gesteuert werden. Die Erlösströme für einen Speicher ergeben sich vor allem aus der Teilnahme an den Regelenergiemärkten (Primär-, Sekundär- und Tertiärreserve) und aus dem Handel auf den Strombörsen (Day-Ahead- und Intraday-Markt). Je nach Standort können auch Netzdienstleistungen wie Redispatch oder Spannungshaltung hinzukommen. Ein effizientes Batteriespeicher-Geschäftsmodell setzt darauf, mehrere dieser Erlösquellen parallel zu erschließen – dieses „Revenue Stacking“ maximiert die Auslastung des
Speichers und die erzielbaren Einnahmen.
Fazit
Batteriespeicher haben sich zu einer zentralen Flexibilitätsressource im modernen Energiesystem entwickelt. Sie ermöglichen es, kurzfristige Schwankungen in Erzeugung und Last auszugleichen, Netzengpässe zu entschärfen und erneuerbare Einspeisung gezielt in verbrauchsstarke Zeiträume zu verschieben. Die Erfahrungen von Verbund zeigen, dass sich mit Speichertechnik, modularen Systemarchitekturen und einer marktorientierten Betriebsführung skalierbare und wirtschaftlich
tragfähige Anlagen realisieren lassen.