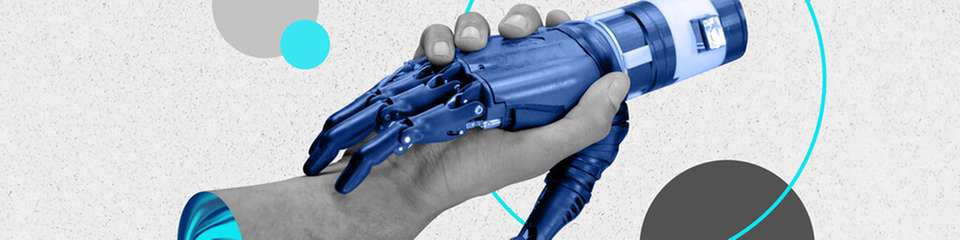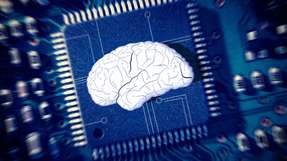Nach den ersten Praxisjahren mit KI stellen sich viele Unternehmen die zentrale Frage: Wo bleibt der ROI? KI-Agenten arbeiten nicht autonom genug, die Modellnutzung leidet unter „Context Rot“ beziehungsweise Qualitätsverlust und klassische Datenbankkonzepte stoßen an ihre Grenzen. Die Graph-Experten von Neo4j zeigen auf, welche Trends den praktischen Einsatz von KI bis 2026 spürbar voranbringen werden.
1. KI-Realitätscheck: Skalierung im Fokus
Die Rückmeldungen aus den Unternehmen sind eindeutig: Die meisten KI-Projekte liefern noch nicht die Ergebnisse, die man sich von ihnen versprochen hat. Laut einer Studie des MIT liefern 95 Prozent der Pilotprojekte keine messbaren Ergebnisse. Gartner rechnet damit, dass 40 Prozent der Agentic-AI-Projekte bis 2027 scheitern werden – gebremst durch Kosten, einen unklaren ROI und ungeklärte Risiken. Hier zeigt sich das GenAI-Paradox: Allgemeine KI-Tools und -Assistenten lassen sich zwar schnell ausrollen, ihre ROI-Effekte sind jedoch nur schwer messbar. Die wirklich wertschöpfenden, vertikal integrierten KI-Systeme kommen dagegen nur mühsam in die Unternehmen.
Von KI-Frust zu sprechen, ist dennoch verfrüht. Der Hype um ChatGPT, Copilot und ähnliche Anwendungen sowie die enormen Investitionssummen der Tech-Riesen haben schlichtweg Erwartungen geweckt, die mit der Realität in Unternehmen kollidieren. Denn hier müssen KI-Systeme tief und sicher in bestehende Prozesse, Datenstrukturen und IT-Landschaften integriert werden. Dieser Prozess braucht Zeit und Anpassungen – und selbst KI kann ihn nur bedingt beschleunigen. Zudem ist KI experimentell: Viele prototypische Projekte müssen scheitern, damit sichtbar wird, welche Ansätze langfristig funktionieren. Die eigentliche Skalierung steht noch bevor.
2. KI-Agenten: Die neuen Trainees
KI-Agenten verdeutlichen dieses Paradox besonders deutlich. Autonome „Agenten-Armeen“, die ganze Abteilungen ersetzen, sind in der Praxis jedoch eher die Ausnahme. Die meisten Systeme arbeiten im Verborgenen und übernehmen vor allem zeitintensive Rechercheaufgaben, beispielsweise in den Bereichen Recht, Compliance oder Medizin. Laut McKinsey experimentiert zwar die Mehrheit der Unternehmen mit KI-Agenten, doch nur 23 Prozent setzen sie in einem produktiven Bereich ein. In keiner Funktion überschreitet der Anteil der skalierten Agenten derzeit 10 Prozent. Das zeigt: Der Nutzen ist hochgradig kontextabhängig und der produktive Einsatz eng begrenzt. Unternehmen müssen zunächst den KI-Hype ausblenden und nüchtern herausfinden, in welchen Bereichen Agenten tatsächlich wirksam sind.
Dieses iterative Vorgehen ist berechtigt, denn KI bleibt unzuverlässig. Meist liegt es nicht an der „fehlenden Intelligenz“ der Modelle. Vielmehr wurden Kontext und Anweisungen nicht klar genug vermittelt, um relevante und zuverlässige Ergebnisse zu garantieren. Für eine funktionsfähige Integration benötigen Agenten daher eine Art Onboarding: Sie müssen eingearbeitet, informiert, überwacht und regelmäßig korrigiert werden – ähnlich wie neue Mitarbeitende. Da sie probabilistisch arbeiten, liefern sie selbst bei identischen Eingaben nicht zwingend dieselben Ergebnisse. Die Validierung erfordert Tests, Feedback und Review-Prozesse, was einen nur begrenzt skalierbaren Aufwand bedeutet.
Dies wirft eine weitere Frage auf, die über die technische Umsetzung hinausgeht: Wie lassen sich KI-Agenten in bestehende Arbeitsabläufe, Teams und die Unternehmenskultur integrieren? Unternehmen müssen dabei nicht nur in das Training und die Einrichtung der KI-Agenten, sondern auch in die Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden investieren. Letztere müssen künftig die Ergebnisse der KI-Kollegen validieren und die zugrunde liegenden Modellgrenzen verstehen. Dafür müssen Arbeitsmodelle neu gedacht werden, einschließlich klarer Governance, neuer Rollen, flacherer Strukturen und besonders eindeutiger Verantwortlichkeiten.
3. Context Engineering: Informationsarchitektur für die KI
KI – selbst in agentischen, iterativen Architekturen – ist nur so gut wie der Kontext, den sie erhält. Doch oft erhält sie zu wenig, zu viel oder zu ungenauen Input. Beim Prompten denken viele an direkte Anweisungen. In realen Anwendungen besteht die eigentliche Aufgabe des Systems jedoch darin, den Kontext dynamisch so zu gestalten, dass das LLM genau die Informationen erhält, die es für den nächsten Schritt benötigt.
LLMs funktionieren in mancher Hinsicht wie das menschliche Arbeitsgedächtnis: Sie behalten den Anfang und das Ende, doch in der Mitte verlieren sie den Faden. Dies zeigt eine Studie der Stanford University. Ein zu langer Kontext führt zu Fehlern, Reibungsverlusten und sinkender Aufmerksamkeit (sogenannter „Context Rot“). Modelle verwirren sich, wenn zu viele oder sehr ähnliche Tools eingesetzt werden (Kontext-Konfusion). Oder sie stolpern über widersprüchliche Arbeitsschritte (Context Clash). Obwohl die Modelle theoretisch riesige Mengen an Kontext verarbeiten könnten, zeigt die Praxis: Je mehr Kontext ins „Context Window“ geladen wird, desto unzuverlässiger sind die Ergebnisse.
In Sachen KI-Kontext gilt daher wie so oft in der Datenverarbeitung: Qualität statt Quantität. Modelle verfügen nur über eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne – ein Konzept, das Anthropic als „Attention Budget“ bezeichnet. Jeder zusätzliche Kontextbaustein verbraucht davon etwas und verwässert das Wesentliche. Gut kuratierter Kontext, also Context Engineering, entwickelt sich damit zur Grundvoraussetzung für verlässliche KI.
4. Push versus Pull: Daten auf Abruf statt auf Vorrat
Mit dem Aufkommen von Agentensystemen verändert sich die Art und Weise, wie KI auf Informationen zugreift. Während frühere Ansätze wie Retrieval-Augmented Generation (RAG) nach dem Push-Prinzip funktionierten, setzt sich nun das Pull-Prinzip durch. Anstatt Informationen im Vorfeld zu sammeln und dem Modell zuzuschieben, entscheidet die KI nun selbst, welche Informationen ihr fehlen, und ruft diese gezielt mittels eines Werkzeugs ab. So entsteht statt einer Informationslawine echte Informationsauswahl.
Damit übernimmt KI zunehmend eine organisatorische Rolle: Sie analysiert Aufgaben, identifiziert Arbeitsschritte und notwendige Informationen und wählt Tools oder Datenquellen aus, um Lücken zu schließen. KI wird so zum Koordinator der Informationsbeschaffung, was ihren Fähigkeiten entgegenkommt. Für Unternehmen bedeutet dies, wie ein Informationsarchitekt zu denken. Entscheidend ist nicht die Menge, sondern die korrekte Dosis, das Prinzip des „Minimum Viable Context“ (MVC). Die KI soll genau die Informationen erhalten, die sie für den nächsten Schritt benötigt – nicht mehr und nicht weniger.
5. Graphen: Navigationssystem für KI-Agenten
Welche Informationen die KI im nächsten Schritt benötigt, hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab: Mal sind es tiefe, lineare Kontextketten, mal breite, verzweigte Wissensstrukturen oder Cluster relevanter Informationen. Manchmal ist auch nur ein einzelner, präziser Ausschnitt erforderlich. Genau an dieser Stelle beginnen klassische Datenstrukturen zu schwächeln. Graphdatenbanken bieten hier einen strukturell anderen Ansatz, den Forrester als Rückgrat für LLMs bezeichnet, um Kontext abzubilden, einzufangen und wieder bereitzustellen.
Gerade im Zusammenspiel mit KI-Agenten rücken Graphen im Jahr 2026 stärker in den Fokus. Da KI-Systeme zunehmend selbstständig Entscheidungen, Tools und Prozesse koordinieren, benötigen sie robuste und nachvollziehbare Kontextmodelle. Graphen verknüpfen Wissen, Aktionen und Interaktionen in Echtzeit und machen Agenten dadurch navigierbar, überprüfbar und skalierbar. So entsteht eine semantische Informationsschicht (Knowledge Layer), die nicht nur präzisere Antworten ermöglicht, sondern vor allem Agenten schafft, die verstehen, wo sie stehen, was sie tun, warum sie es tun und welche Folgen der nächste Schritt hat.
6. Datenbank der Zukunft: Adaptiv
Datenbanken und Dateninfrastrukturen entwickeln sich somit zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg von KI. Nach vier Jahren KI-Hype stellt sich dabei immer deutlicher heraus: Während Hardware und Modelle in neue Dimensionen vorstoßen, stecken die darunterliegenden Datenbanken noch immer im Denken der 70er-Jahre fest. KI-Systeme sollen Spitzenleistungen liefern, arbeiten aber auf Architekturen, die nie für sie entwickelt wurden. Die zentrale Frage lautet daher nicht mehr, wie Datenbanken verbessert werden können, sondern wie eine Datenbank aussehen muss, die für KI konzipiert ist.
Eine KI-Datenbank der nächsten Generation könnte beispielsweise ähnlich wie „Live Code“ funktionieren. Abfragen werden während der Ausführung iterativ neu geschrieben und verbessert, angelehnt an moderne Compiler-Designs wie Just-in-Time-(JIT)-Techniken. Der Ausführungsplan passt sich dabei laufend an Datenverteilungen, Lastmuster und die jeweils verfügbare Hardware an. So entsteht eine permanente Feedbackschleife, in der die Datenbank mit jeder Iteration effizienter wird – selbst wenn Komplexität und Datenmengen wachsen. Genau diese dynamische Architektur bildet das Fundament für die Knowledge Layer, die KI-Agenten künftig benötigen werden.