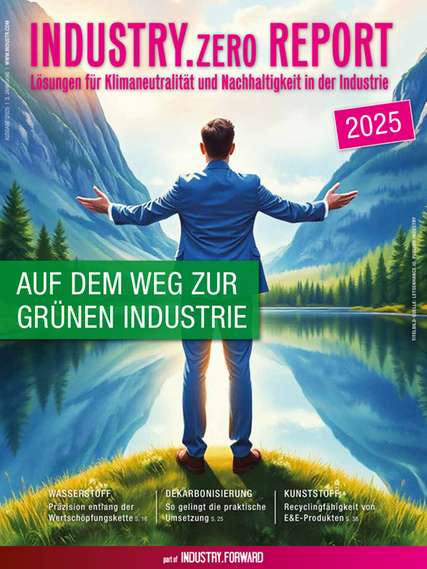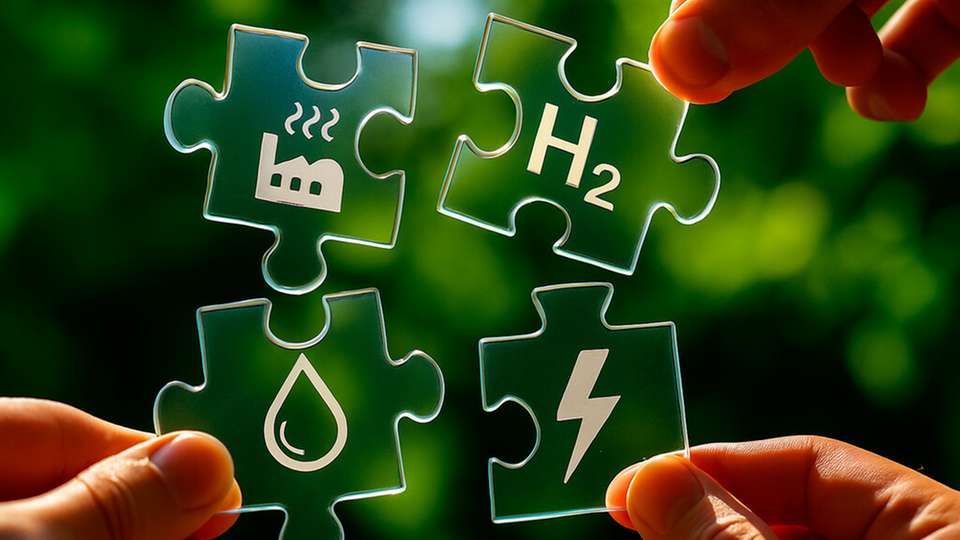Grüner Wasserstoff kann die deutsche Wirtschaft zukunftsfest machen. Neben Importen sind kostengünstige heimische Elektrolyseure notwendig, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme wirtschaftlich nutzen. Den Weg dorthin zeigt die neue Versuchsanlage „LA-SeVe” in Zittau. In dieser Anlage wird erstmals die Wärmeauskopplung aus der PEM-Elektrolyse in Verbindung mit einer Wärmepumpe erprobt. Die Anlage wurde nun von den Projektpartnern und Fördermittelgebern eingeweiht. Die Anlage ist im Rahmen des Projekts „IntegrH2ate” als Teil des Wasserstoff-Leitprojekts H2Giga entstanden und wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) gefördert. Nun wurde die Versuchsanlage im Beisein der Projektpartner und Fördermittelgeber eingeweiht.
Pilotanlage koppelt Elektrolyseur mit Wärmepumpe
„Wasserstoff wird der entscheidende Baustein sein, um auch die schwer zu dekarbonisierenden Industrien zukunftsfest aufzustellen. Chemie, Stahl und Schwerlastverkehr brauchen grünen Wasserstoff, und dessen Erzeugung öffnet neue Wertschöpfung am Standort Deutschland“, erklärt Prof. Mario Ragwitz, Leiter des Fraunhofer IEG. „Mit der neuen Anlage zeigt die Energieregion Lausitz, wie man seine bewährten Kompetenzen für die Zukunft einsetzt. Wir freuen uns, mit der Laboranlage zum gelingenden Strukturwandel in der Lausitz beizutragen.“
„Die Forschung von heute wird zu Technologie und Wertschöpfung von morgen. Sie sichert internationale Stärke und technologische Souveränität auf dem Gebiet der klimaneutralen Energieversorgung. Das ist ganz im Sinne der Hightech Agenda Deutschland. Hier in Zittau ist die Forschung außerdem ein Baustein des Strukturwandels, der traditionelle Kompetenzen weiterentwickelt und zur Gestaltung der Zukunft einsetzt. Das Fraunhofer IEG und alle Beteiligten an der neuartigen Laboranlage, die mein Haus im Rahmen des Vorhabens IntegrH2ate fördert, zeigen hier in Zittau, wie Forschung an Wasserstofftechnologien ganz praktisch einsetzbar wird und zum Strukturwandel beitragen kann“, so die Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Dorothee Bär.
„Das neue Zittauer Fraunhofer IEG kann bei unseren Stadtwerken und der Hochschule Zittau/Görlitz auf eine gewachsene und äußerst konstruktive Partnerschaft aufbauen. Genau so wird anwendungsnahe Forschung mit relevanten Erkenntnissen für die Energiewende ermöglicht, die in die Lausitz und darüber hinaus ausstrahlen“, freut sich Oberbürgermeister Thomas Zenker. „Wir können in unserer Hochschulstadt Zittau stolz darauf sein, wenn mit dem Fraunhofer IEG ein weiterer innovativer Akteur die Netzwerke am Forschungsstandort Zittau ergänzt.“
„Das ist eine gute Nachricht für das Projekt ‚IntegrH2ate‘ und das Wasserstoff-Leitprojekt ‚H2Giga‘“, ergänzt Thomas Emmert von Linde, Gesamtprojekt-Koordinator von „IntegrH2ate“. „Damit werden wir nachweisen, dass die Auskopplung und die effektive Nutzung des Elektrolyseproduktes Wärme die Wirtschaftlichkeit der Elektrolyse verbessert. Mittelfristig wird dies die Umsetzung von Elektrolyseprojekten mit Sektorenkopplung vorantreiben und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft unterstützen.“
Forschung testet effiziente Nutzung von Elektrolyse-Nebenprodukten
Im Projekt „IntegrH2ate“ wird die Kopplung zwischen PEM-Elektrolyse, Wärmepumpe und Wärmenetz untersucht. Die Abwärme aus der Elektrolyse wird durch die Wärmepumpe so aufgewertet, dass sie als Fernwärme im Versorgungsnetz der Stadt genutzt werden kann. Auch der Sauerstoff aus der Elektrolyse ist bei entsprechender Reinheit eine gefragte Handelsware. Die nun erstellte Versuchsanlage dient primär der Betriebsoptimierung des innovativen Anlagenkonzepts sowie der effizienten Kopplung von Elektrolyseuren und Wärmepumpen bei strom-, wärme- oder wasserstoffgeführter Betriebsweise. Je nachdem, ob der Fokus auf die Nutzung von grünem Überschussstrom, die Einsparung fossiler Energieträger oder die optimale Wasserstoffherstellung liegt, ändern sich Betriebsweise und Betriebsparameter. Mit der Anlage in Zittau prüft das Projektteam nun die in den letzten Jahren entwickelten Konzepte der industriellen Sektorenkopplung in der Praxis.
„Mit unseren Versuchsanlagen schaffen wir eine Test-Infrastruktur, um industrienahe Prozesse zu testen und zu qualifizieren“, sagt Clemens Schneider, Projektleiter am Fraunhofer IEG. „Wir erproben im Technikums-Maßstab, wie sich die Nebenprodukte Wärme und Sauerstoff aus der Elektrolyse bei dynamischer Betriebsweise optimal aufbereiten lassen. Zudem stellt die Versuchsanlage eine Plattform dar, um zukünftig industrienahe Prozesse für Hersteller und Betreiber zu testen und zu qualifizieren. Beispielsweise die Methanisierung von Kohlendioxid, geschlossene Kohlestoffkreisläufe, Tests von Verdichtern für Sauerstoff und Wasserstoff sowie Wasserstoff-Brenner und weitere Komponenten zur Nutzung der Haupt- und Nebenprodukte aus der PEM-Elektrolyse. Wir finden Lösungen für die aktuellen Herausforderungen der Verfahrenstechnik und Systemintegration von Energieanlagen.“
Protonenaustauschmembranen, auch Polymer-Elektrolyt-Membranen (PEM) genannt, werden in der Elektrolyse zur Trennung der beiden Elektroden verwendet und lassen nur gezielt Reaktionsprodukte hindurch. PEM-Elektrolyseure besitzen eine gute Teillastfähigkeit und einen hohen Wirkungsgrad. Sie sind unempfindlich gegenüber Lastwechseln. Insofern eignen sie sich besonders für die Wasserstoffproduktion mit Strom aus volatilen erneuerbaren Quellen.
Die „Laboranlage Sektorengekoppelte Verwertung der PEM-Elektrolyseprodukte“ (LA-SeVe) wurde mit einer Investition von 2,7 Millionen Euro auf dem Gelände der Stadtwerke Zittau errichtet. Der Elektrolyseur befindet sich in einem rund 12 m langen und 2,5 m breiten Containerraum und wird über eine neue Trafostation mit Strom versorgt. Die Wärmepumpe mit einer Leistung von maximal 105 kW (thermisch) erhielt zusammen mit Pufferspeicher, Pumpen und Regelungstechnik eine 5 × 5 m große Standfläche in einer bestehenden Halle. Sie ist über einen Wasserkreislauf an den Elektrolyseur angebunden. Die Abwärme aus dem Forschungsbetrieb des Elektrolyseurs gelangt über die Wärmepumpe in das städtische Fernwärmenetz.
Fraunhofer IEG in Zittau
Am Standort Zittau forscht das Fraunhofer IEG konkret, anwendungsnah und mit Blick auf die regionale Industrie sowie die kommunale Wärmeversorgung. Im Fokus stehen Technologien zur effizienten Wandlung verschiedener Energieformen wie Strom und Wärme. „Weiterhin analysieren wir industrielle Prozesse sowie Umweltwärmequellen und konzeptionieren Lösungen zur Aufwertung und Einbindung dieser ungenutzten Wärmepotenziale im Gesamtprozess“, ergänzt Schneider, der den Standort Zittau des Fraunhofer IEG leitet. Die Innovationen sollen aufzeigen, welche Rolle regenerative Wärmequellen in zukunftsfesten Wärmenetzen für Haushalte, Gewerbe und Industrie spielen. Es entstehen Verfahren zur effizienten Kopplung der Sektoren Strom, Gas und Wärme, etwa durch die geeignete Nutzung der bei der Elektrolyse anfallenden Produkte oder durch sektorenübergreifende Nutzungsszenarien von Elektrolyseuren in zentralen und dezentralen Anlagen und Systemen.
Das Projekt „IntegrH2ate“ ist Teil des Wasserstoff-Leitprojekts „H2Giga“ und befasst sich mit der effizienten Nutzung der bei der PEM-Elektrolyse entstehenden Nebenprodukte Wärme und Sauerstoff. Bei der Wasserstoff-Elektrolyse mittels Protonenaustauschmembran (PEM) wird etwa ein Drittel der eingesetzten elektrischen Energie in Abwärme umgewandelt. Zudem bleibt der beim Elektrolyseprozess anfallende Sauerstoff meist ungenutzt. Im Projekt „IntegrH2ate“ untersuchen die Projektpartner die Verwertung dieser Nebenprodukte. Das Ziel der Untersuchungen im Technikumsmaßstab ist eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit der Wasserstoffproduktion mittels PEM-Elektrolyseuren. Konsortialpartner im Projekt „IntegrH2ate“ sind die Linde GmbH und das Fraunhofer IEG mit seinem Standort Zittau. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert das Projekt mit rund zehn Millionen Euro, wovon etwa 4,2 Millionen Euro an das Fraunhofer IEG gehen. Die Versuchsanlage „LA-SeVe“ hat Pilotcharakter und ist ein Alleinstellungsmerkmal des Projekts.