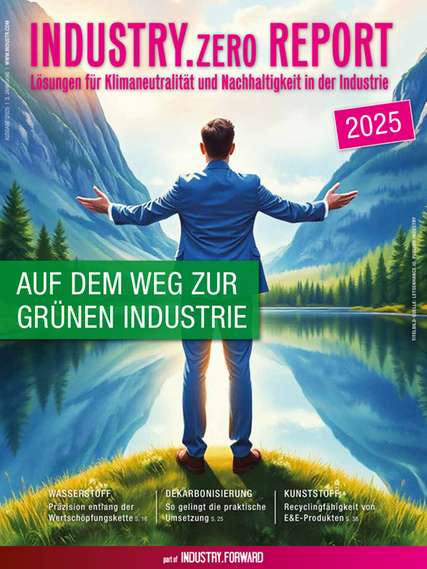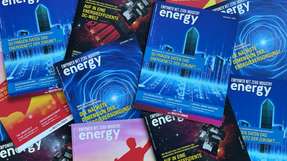Bei Hagdorn Tomaten sind der Energieeinsatz und die Erzeugung von Strom und Wärme intelligent gekoppelt. Die dadurch gewonnene Flexibilität nutzt das Unternehmen für eine marktorientierte Vermarktung von Energiekapazitäten. Über den Zugang zu den Strombörsen und dem Regelenergiemarkt der LEW erzielt der Gärtnereibetrieb zusätzliche Einnahmen in Höhe von 100.000 Euro.
„Für Tomaten ist Wärme ein Wachstumselixier, für Erzeuger ein Kostenfaktor.“ Heiko Hagdorn ist Geschäftsführer des Familienbetriebs und bewirtschaftet im baden-württembergischen Hochdorf an der Enz eine Tomatenplantage. Das rund 60.000 m2 große Treibhaus bietet den Pflanzen konstante, sommerliche Temperaturen – unabhängig von Jahreszeit und Wetter. „Damit wir trotz des dafür hohen Energiebedarfs nachhaltig und wettbewerbsfähig produzieren, haben wir eine unternehmenseigene, hocheffiziente Energieinfrastruktur aufgebaut: Wärmepumpen, Wärmespeicher, PV-Anlage und LED-Belichtung sowie mit Gas betriebene Blockheizkraftwerke, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugen“, sagt Hagdorn. Das System bietet drei entscheidende Vorteile:
Energie wird flexibel – und zwar sowohl beim Stromverbrauch als auch in der Erzeugung von Wärme und Strom.
Das Unternehmen kann selbst über die jeweils (kosten-)effizienteste Quelle für Wärme und Strom entscheiden.
Die Anlage ist so dimensioniert, dass sie einen Großteil des erzeugten Stroms ins Netz einspeisen kann, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.
„Stromabnehmer und Stromlieferant – wir können beide Rollen übernehmen. Je nachdem, was im Energiesystem gebraucht wird. Das Einspeisen ist vor allem dann lukrativ, wenn die Stromnachfrage hoch und das Stromangebot niedrig ist. Oder es, wie bei der Regelenergie, Zuschläge für die Bereithaltung und den Abruf gibt“, betont Hagdorn. „Und bei einem Überangebot an Strom können wir von den dann günstigen Preisen profitieren oder sogar Zusatzerlöse erzielen. Dafür benötigt der Betrieb allerdings einen Zugang zu den Energiebörsen und das Know-how, um die jeweils besten Vermarktungsoptionen zu nutzen.“ Beides, so Hagdorn, bietet ihm die LEW.
Energieeinsatz marktorientiert steuern
Bei Hagdorn wird der Wärmebedarf des Betriebs vor allem nach der Marktlage an den Strombörsen erzeugt. Je nach Angebot kann das Unternehmen zwischen den Energiequellen wechseln: Mal springen die Blockheizkraftwerke an, weil die Preise an der Strombörse hoch sind. Ein anderes Mal arbeiten die Wärmepumpen auf Volllast, um Strom aus dem Netz zu ziehen, wenn der Netzbetreiber negative Regelenergie abruft oder weil an der Börse negative Strompreise aufgerufen werden. Dann zahlt der Betrieb (abgesehen vom Netzentgelt) für seinen Stromverbrauch nichts. Im Gegenteil: Er wird dafür sogar bezahlt. „Das flexible Nutzen und Ineinandergreifen der einzelnen Systeme hat unsere Energiekosten um fast ein Drittel reduziert“, rechnet Hagdorn vor.
Die Schaltzentrale ist ein Energieregler, in dem Sollwerte und Mindestanforderungen hinterlegt sind. Er erfasst laufend Kennzahlen wie Füllstände, Wärmebedarf und Anlagenzustände und steuert die Anlage automatisch. Die Daten werden an die zentralen Softwarebausteine des LEW-Handelsteams übermittelt. Mittels KI-Anwendungen, Machine Learning und mathematischen Verboesserungsverfahren ermitteln automatisierte 24/7-Berechnungen die Vermarktung der Anlage.
Das LEW-Vermarktungssystem platziert die entsprechenden Optionen dann an den Strombörsen – vom Day-Ahead- und Intraday-Markt bis hin zu den Märkten für Regelenergie. Das Handelsteam von LEW prüft die Berechnungen der Verbesserungsmodelle laufend und entwickelt sie kontinuierlich weiter. „Für uns ist das Ganze weitgehend ein Selbstläufer. Wie gewinnbringend das System arbeitet, sehen wir jeden Monat schwarz auf weiß auf der Abrechnung“, unterstreicht Hagdorn.
Automatisierte Flexvermarktung
Hagdorn Tomaten nutzt seit fünf Jahren die markt- und betriebsoptimierte Flexvermarktung. Damit erzielt der Betrieb zu den aktuellen Marktkonditionen Mehrerlöse von bis zu 100.000 Euro jährlich. Und es könnten sogar noch mehr werden. „Gemeinsam mit der LEW arbeiten wir an Lösungen, die unser Energiesystem noch wirtschaftlicher machen“, erzählt Hagdorn. Ein aktuelles Beispiel ist das Gas: Aufgrund der hohen Lastspitzen hat Hagdorn das System so angepasst, dass seine Blockheizkraftwerke nur noch mit maximal 80 Prozent ihrer elektrischen Leistung arbeiten. Dafür sollen sie länger laufen, sofern das Angebot am Markt lukrativ erscheint.
Sektorkopplung als Effizienzbooster
„Dank unseres intelligent vernetzten Energiesystems haben wir beides erreicht: maximale Flexibilität, um mit unserer Energie gutes Geld zu verdienen, und die Sicherheit, dass unsere Pflanzen optimal gedeihen“, betont Hagdorn. Die nötige Heizenergie speichert das Unternehmen in zwei Pufferspeichern mit einer Gesamtkapazität von 80 MWh. Beladen werden diese von zwei Wärmepumpen mit je 0,7 MW elektrischer Leistung sowie von zwei gasbetriebenen Blockheizkraftwerken, die jeweils 1,6 MW Strom und Wärme erzeugen.
Zusätzlich liefert eine 345 kWp große Photovoltaikanlage auf dem Dach des Verpackungsbetriebs erneuerbare Energie. Die LED-Beleuchtung, mit der die Pflanzen zur Unterstützung des Wachstums belichtet werden, hat eine elektrische Leistungsaufnahme von 1,5 MW. Auch das an den Blockheizkraftwerken freigesetzte CO2 bleibt nicht ungenutzt: Es wird aufgefangen, gereinigt und als Dünger weiterverwendet. Die Treibhausluft wird mit dem Gas angereichert. Die Pflanzen nehmen das CO2 über die Photosynthese auf und wandeln es in organische Substanz und Wachstum um.