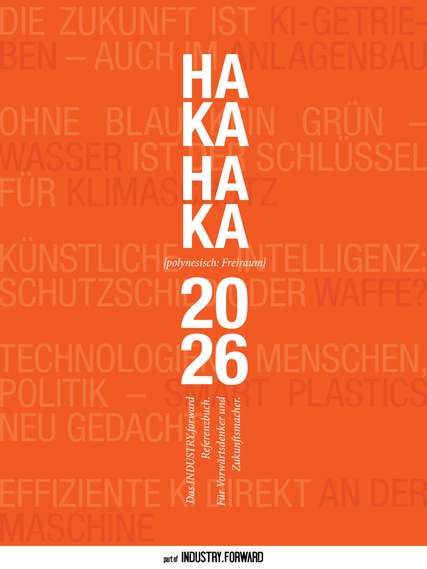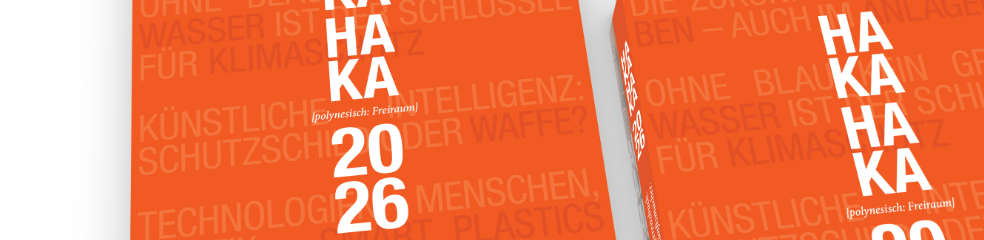Flugwindenergieanlagen nutzen die konstanten Höhenwinde in 200 bis 600 m Höhe, um dort effizient Strom zu erzeugen, wo herkömmliche Windkraftanlagen physikalisch und wirtschaftlich an ihre Grenzen stoßen. Anstelle von Türmen und Rotorblättern besteht das System aus einer Bodenstation, drei Seilen und einem automatisch gesteuerten Kite, der in achtenförmigen Schleifen durch die Luft fliegt. Die Zugkraft des Kites wird über Seilwinden in der Bodenstation in elektrische Energie umgewandelt. Im Vergleich zu konventionellen Windkraftanlagen erzeugen Flugwindenergieanlagen fast die doppelte Menge an Strom bei deutlich geringerem Materialeinsatz (10 Prozent im Gegensatz zu normalen Windkraftanlagen). Kleinere Onshore-Windenergieanlagen erreichen oft nur 1.000 Volllaststunden pro Jahr – Flugwindenergieanlagen dieser Leistungsklasse dagegen bis zu 5.000, bei über 8.000 Betriebsstunden pro Jahr.
Die Energieerzeugung erfolgt zyklisch: Der Kite fliegt in einer sogenannten Powerphase achtenförmige Schleifen, erzeugt dabei Strom, wird anschließend mit geringem Energieaufwand zurückgezogen und beginnt von vorne. Die Steuerung erfolgt vollautomatisch. Auch bei Windstille kann gestartet werden – ein rotierender Mast bringt den Kite in die gewünschte Flughöhe. Diese Anlagen sind sowohl mobil als auch stationär nutzbar. Die Anlagen eignen sich dabei für netzferne Anwendungen oder temporäre Standorte, als auch für die landwirtschaftliche oder industrielle Eigenstromversorgung. Durch die modulare Skalierbarkeit und die Containerbauweise sind flexible Einsatzmöglichkeiten mit einfachem Transport und Installation gegeben.
Typische Anwendungsfelder sind beispielsweise die Eigenstromversorgung, der Dieselersatz in abgelegenen Regionen und die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität. Aus wirtschaftlicher Sicht zeigen Beispielrechnungen für mittlere Windstandorte Stromgestehungskosten von unter 10 Cent/kWh und Amortisationszeiten von etwa sieben bis zehn Jahren. Jedoch können Förderungen durch Einspeisevergütungen die Wirtschaftlichkeit noch weiter verbessern. Genehmigungsrechtlich profitieren Flugwindkraftanlagen davon, dass sie unterhalb der Schwellenwerte für große Windkraftprojekte liegen. Sicherheitsabstände zu Siedlungen und Infrastruktur werden durch ein technisches Integrationskonzept und Luftraummarkierungen eingehalten. Mehrere Anlagen können durch synchronisierte Flugmuster auf engem Raum betrieben werden.
Zudem ist das System robust gegenüber Witterungsbedingungen. Regen und Schnee beeinträchtigen den Betrieb nicht, bei Gewitter oder Sturm wird automatisch gelandet. Der Geräuschpegel ist minimal – im Normalbetrieb praktisch nicht hörbar. Die Unterschiede im Energieertrag zwischen Sommer und Winter sind nur gering, da durch die Höhenanpassung flexibel auf wechselnde Windverhältnisse reagiert werden kann.
Flugwindenergieanlagen bieten eine leistungsstarke, skalierbare und netzunabhängige Ergänzung zu bestehenden Erneuerbare-Energien-Technologien – insbesondere dort, wo die klassische Windenergie an ihre Grenzen stößt. Für Industrie, Mittelstand und Landwirtschaft als auch für abgelegene Regionen eröffnen sich damit neue Wege zu einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Stromversorgung.