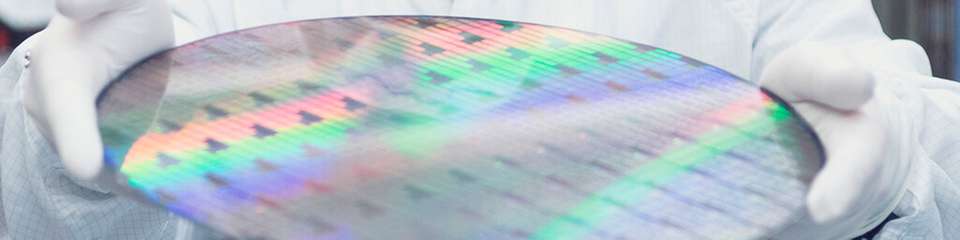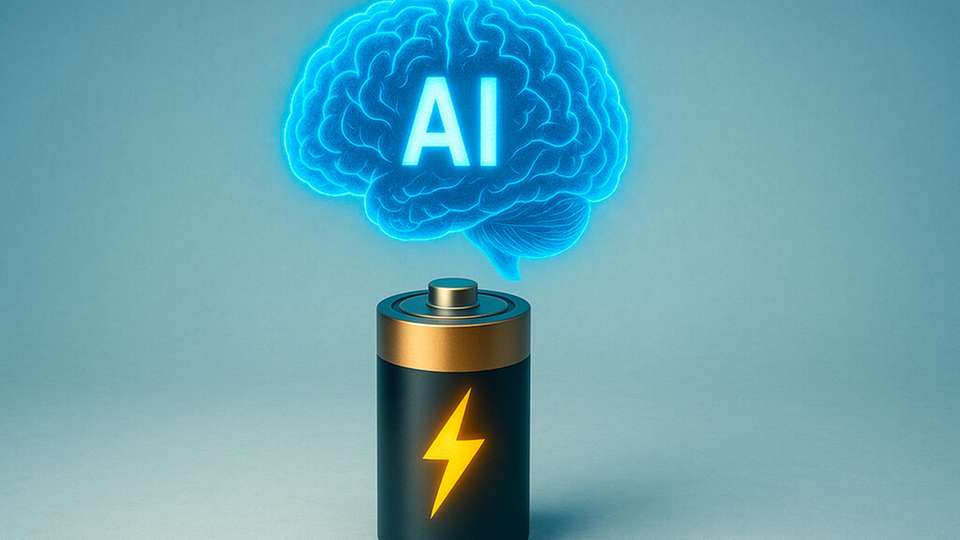Forscher des New Jersey Institute of Technology (NJIT) haben Künstliche Intelligenz eingesetzt, um ein entscheidendes Problem für die Zukunft der Energiespeicherung anzugehen: die Suche nach erschwinglichen, nachhaltigen Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. In einer neuen Studie gelang es dem NJIT-Team unter der Leitung von Professor Dibakar Datta, mithilfe generativer KI-Techniken schnell neue poröse Materialien zu entdecken, die eine nachhaltige Veränderung bei Multivalent-Ionen-Batterien bewirken könnten. Diese Batterien, die reichlich vorhandene Elemente wie Magnesium, Kalzium, Aluminium und Zink verwenden, bieten eine vielversprechende, kostengünstige Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien, die mit globalen Versorgungsproblemen und Nachhaltigkeitsfragen konfrontiert sind.
Potenzial multivalenter Ionenbatterien
Im Gegensatz zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien, die auf Lithium-Ionen basieren, die nur eine einzige positive Ladung tragen, verwenden multivalente Ionenbatterien Elemente, deren Ionen zwei oder sogar drei positive Ladungen tragen. Das bedeutet, dass multivalente Ionenbatterien potenziell deutlich mehr Energie speichern können, was sie für zukünftige Energiespeicherlösungen sehr attraktiv macht. Allerdings erschweren die größere Größe und die höhere elektrische Ladung multivalenter Ionen deren effiziente Einbindung in Batteriematerialien – ein Hindernis, das das NJIT-Team mit seiner neuen KI-gestützten Forschung direkt angeht.
„Eine der größten Hürden war nicht der Mangel an vielversprechenden Batteriechemien – es war die schiere Unmöglichkeit, Millionen von Materialkombinationen zu testen“, sagte Datta. „Wir haben uns der generativen KI zugewandt, um schnell und systematisch diese riesige Landschaft zu durchforsten und die wenigen Strukturen zu finden, die multivalente Batterien wirklich praktikabel machen könnten. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, schnell Tausende potenzieller Kandidaten zu untersuchen und so die Suche nach effizienteren und nachhaltigeren Alternativen zur Lithium-Ionen-Technologie erheblich zu beschleunigen.“
KI-gesteuerte Materialforschung
Um diese Hürden zu überwinden, entwickelte das NJIT-Team einen neuartigen dualen KI-Ansatz: einen Crystal Diffusion Variational Autoencoder (CDVAE) und ein fein abgestimmtes Large Language Model (LLM). Zusammen ermöglichten diese KI-Tools die schnelle Untersuchung Tausender neuer Kristallstrukturen, was mit herkömmlichen Laborexperimenten bisher unmöglich war.
Das CDVAE-Modell wurde anhand umfangreicher Datensätze bekannter Kristallstrukturen trainiert, sodass es völlig neuartige Materialien mit vielfältigen strukturellen Möglichkeiten vorschlagen kann. Das LLM wurde hingegen darauf abgestimmt, Materialien zu identifizieren, die der thermodynamischen Stabilität am nächsten kommen, was für die praktische Synthese von entscheidender Bedeutung ist.
„Unsere KI-Tools haben den Entdeckungsprozess erheblich beschleunigt und fünf völlig neue poröse Übergangsmetalloxidstrukturen aufgedeckt, die vielversprechend sind“, sagte Datta. „Diese Materialien verfügen über große, offene Kanäle, die ideal sind, um diese sperrigen mehrwertigen Ionen schnell und sicher zu transportieren – ein entscheidender Durchbruch für Batterien der nächsten Generation.“
Von der Theorie zur Praxis
Das Team validierte die von der KI generierten Strukturen mithilfe quantenmechanischer Simulationen und Stabilitätstests und bestätigte, dass die Materialien tatsächlich experimentell synthetisiert werden können und ein großes Potenzial für praktische Anwendungen haben. Datta betonte die weitreichenden Auswirkungen ihres KI-gestützten Ansatzes: „Es geht hier um mehr als nur die Entdeckung neuer Batteriematerialien – es geht darum, eine schnelle, skalierbare Methode zu etablieren, um beliebige fortschrittliche Materialien, von Elektronik bis hin zu Lösungen für saubere Energie, ohne umfangreiche Versuche und Irrtümer zu erforschen.“
Angesichts dieser ermutigenden Ergebnisse planen Datta und seine Kollegen eine Zusammenarbeit mit experimentellen Labors, um ihre KI-entworfenen Materialien zu synthetisieren und zu testen und damit die Grenzen für kommerziell nutzbare multivalente Ionenbatterien weiter zu verschieben.