Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen, mit denen die Lebensmittel- und Getränkeindustrie derzeit zu kämpfen hat?
Da gibt es drei große Themenblöcke, die im Prinzip alle betreffen. Erstens die Nachhaltigkeit: Energie und Ressourcen sind nicht nur teurer geworden, sie sind auch schwerer planbar. Wer heute in Deutschland produziert, spürt den Kostendruck noch stärker, weil die Energiepreise hier im internationalen Vergleich höher sind. Zweitens die Digitalisierung – und damit meine ich nicht nur Automatisierung, sondern vor allem auch Datensicherheit. Ab 2027 gilt der Cyber Resilience Act. Das wird für viele Unternehmen ein Weckruf, weil er zwingend vorschreibt, wie Anlagen abgesichert werden müssen. Und drittens die geopolitische Lage: Unsicherheiten durch Handelsbeschränkungen, neue Steuermodelle oder Exportauflagen. Alle drei Faktoren greifen ineinander. Wenn ein Unternehmen nachhaltiger werden will, kommt es automatisch mit Digitalisierung in Berührung. Und wenn es digitalisiert, muss es gleichzeitig in IT-Sicherheit investieren.
Beim Energieverbrauch ist die Branche ein Schwergewicht. Global 30 Prozent Energieverbrauch, 20 Prozent Emissionen – reicht das, was die Unternehmen bisher tun?
Es bewegt sich was, aber es reicht nicht. Klar, viele Unternehmen investieren, stellen auf effizientere Prozesse um, setzen sich Ziele zur Dekarbonisierung. Aber die Dimension ist riesig. 30 Prozent weltweiter Energieverbrauch – das ist kein Nischenthema, das ist eine Großbaustelle. Und oft wird unterschätzt, dass man gar nicht immer den großen Wurf braucht. Natürlich ist es schön, wenn man eine ganze Linie modernisiert oder ein neues Werk nach höchsten Standards baut. Aber viel häufiger geht es darum, im Bestand kleine Schritte zu machen: alte Motoren austauschen, Prozesse optimieren, Lastspitzen reduzieren. Das Schöne ist, dass diese Schritte sofort Wirkung zeigen – bei den Kosten und beim CO2-Footprint.
Sie erwähnten Motoren, wie groß ist der Hebel der Antriebstechnik in diesem Zusammenhang?
Riesig! Es ist tatsächlich so, dass gerade im Food & Beverage-Bereich viele Motoren noch „hart am Netz“ sind. Das bedeutet, sie werden direkt ohne Frequenzumrichter betrieben – es gibt also keine Regelung. Wenn ich das Nicht-Technikern erkläre, sage ich immer: „Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Auto ohne Kupplung, haben nur Vollgas und Stopp und können nicht schalten“. Dann setzt langsam das Verständnis ein. Die Motoren sind der ausschlaggebende Punkt für hohe Energiekosten. Viele laufen im Volllastbetrieb, obwohl die Anwendung das gar nicht benötigt. Mit Frequenzumrichtern und neuen energieeffizienten Motoren im Paket bieten wir eine schnelle Möglichkeit, punktuell die Leistung und damit die Kosten zu senken. Der Aufwand für die Umsetzung ist nicht groß, und es lässt sich sehr gut berechnen, wann sich die Investition amortisiert. Gerade in Schichtbetrieben, die im Food & Beverage-Bereich sehr häufig sind, liegt hier das größte Einsparpotenzial.
Aber viele Motoren laufen seit Jahrzehnten ohne Probleme. Warum sollte man funktionierende Technik austauschen?
Genau das ist die typische Argumentation: „Solange er läuft, ist alles gut.“ Aber das stimmt eben nicht. Ja, ein Motor hält oft 40 oder 50 Jahre – ABB ist da bekannt für ihre Qualität. Nur: Ein Antrieb der vor 30 Jahren gebaut wurde, hat keine Effizienzklasse. Heute sprechen wir über IE5 oder sogar IE6. Der Unterschied ist gewaltig. Ein alter Motor, der 24/7 im Vollastbetrieb läuft, verbraucht Unmengen an Energie. Setze ich einen modernen Synchronreluktanzmotor mit Frequenzumrichter ein, sind Einsparungen von 40 bis 50 Prozent möglich. Und das ist nicht graue Theorie. Wir haben das in vielen Projekten nachgewiesen. Wenn man das auf zehn, zwanzig oder fünfzig Stück hochrechnet, reden wir über Beträge, die Millionen einsparen können. Das Problem ist: Viele sehen den Verbrauch nicht direkt, weil die Kosten im Gesamtkonto verschwinden. Aber sobald man es transparent macht, ist es offensichtlich.
Heißt das, solche Modernisierungen der Antriebstechnik sind für die Food & Beverage-Industrie der ideale Einstieg in größere Digitalisierungsprojekte?
Ganz genau. Wir nennen das Quick Wins. Und wenn jemand ganz klein anfangen will, haben wir dafür unseren Smart Sensor. Diese Lösung kann man sogar auf sehr alten Motoren anbringen – man muss nichts umbauen. Damit lassen sich Temperatur, Schwingungen oder Energieverbrauch erfassen. Der Kunde sieht sofort: „So verhält sich mein Motor.“ Und wenn man diese Daten mit einem modernen IE5-Motor vergleicht, wird schwarz auf weiß sichtbar, was für ein Einsparpotenzial vorhanden ist. Ich habe Fälle erlebt, wo wir Einsparungen von 50 Prozent nachgewiesen haben. Wenn ein Geschäftsführer diese Zahl vor sich sieht, ist die Diskussion beendet. Von da aus bauen wir Schritt für Schritt auf: mehr Sensoren, ganze Linien, Cloud-Dashboards, Energiemanagementsysteme nach ISO 50001. Und plötzlich ist man mitten in der Digitalisierung, ohne dass es sich so angefühlt hat. ABB hat da den Vorteil, dass wir das gesamte Portfolio abdecken – vom Motor über den Frequenzumrichter bis hin zur Cloud-Lösung. Aber der erste Schritt ist fast immer klein. Und das ist auch völlig in Ordnung. Vertrauen wächst Schritt für Schritt.
Gibt es Lösungen, die speziell auf Food & Beverage zugeschnitten sind?
Ja, natürlich. Ein Beispiel ist unser neuer LV Titanium Variable Speed Motor. Das ist eine Kombination aus Motor und Frequenzumrichter auf einer Plattform. Er wird dezentral direkt an der Maschine montiert, nicht mehr im Schaltschrank. Der Vorteil: keine langen Kabelwege, keine zusätzlichen Filter, keine aufwendige Parametrierung. Alles wird bei uns im Werk getestet und abgestimmt. Für Retrofit-Projekte ist das ideal: alter Motor raus, ABB LV Titanium rein, und sofort läuft die Applikation effizienter. Gerade in Förderanwendungen, wo lange Kabel zu Störungen führen, ist das ein echter Game Changer. Dezentralisierung ist bereits ein großer Trend – viel kürzere Motorkabel, weniger Störimpulse, mehr Flexibilität, weniger Ausfälle.
Man kommt ja kaum daran vorbei: Welche Rolle spielt eigentlich KI in der Antriebstechnik?
KI ist mehr als ein Buzzword. Sie ermöglicht uns Predictive Maintenance. Das heißt, wir erkennen Fehler, bevor sie passieren. Das ist ein riesiger Vorteil, gerade in einer Branche, wo ein Produktionsausfall extrem teuer ist. Denken Sie an eine Charge Getränke, die wegen eines technischen Defekts nicht verwendet werden kann – das sind sofort zehntausende Euro. Mit KI sehen wir Abweichungen im Betrieb, können warnen und präventiv eingreifen. Und durch Remote-Zugriff können wir weltweit unterstützen, egal ob die Maschine in Deutschland oder in Asien steht. Die Pandemie und die Lieferengpässe haben gezeigt, wie wichtig das ist. Viele Unternehmen haben damals verstanden: Wir können nicht mehr warten, wir müssen unsere Anlagen resilienter machen.
Wenn Sie nach vorne blicken, wohin entwickelt sich die Antriebstechnik in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Drei Trends sehe ich klar: Automatisierung, Dezentralisierung und Datennutzung. Dezentral heißt: mehr Lösungen direkt an der Maschine. Automatisierung heißt: nicht nur klassische SPS, sondern intelligente Systeme, die Daten sammeln und auswerten. Und Datennutzung heißt: Cloud, KI, Analytik. Energieeffizienz bleibt selbstverständlich das zentrale Thema. Aber die eigentliche Revolution ist, dass wir die vorhandenen Daten endlich nutzen, um Produktion sicherer, effizienter und resilienter zu machen. Mein Appell ist: Warten bringt nichts. Die moderne Technologie ist da und sie ist erprobt. Wer sie nicht nutzt, riskiert, den Anschluss zu verlieren.
Und warum sollte ein Unternehmen dabei auf ABB setzen?
Weil wir das große Ganze abdecken können. Viele Anbieter sind Spezialisten für eine Nische. Wir nicht. Wir können einen einzelnen Motor tauschen, aber auch einen kompletten Produktionsstandort optimieren. Unser Lösungsportfolio reicht von der Hardware über die Software bis hin zur Cloud-Lösung. Und wir arbeiten mit offenen Schnittstellen – wir können also auch mit Fremdmotoren oder -umrichtern kommunizieren. Das ist gerade für kleinere Unternehmen wichtig, die nicht gleich alles austauschen wollen. Dazu kommt unser Partnernetzwerk: lokale Experten, die schnell vor Ort sind. Das macht uns flexibel. Und wir bringen über 100 Jahre Erfahrung mit. Das ist ein Paket, das nicht viele bieten können. Am Ende geht es darum, dass der Kunde Vertrauen hat – und das entsteht, wenn man Schritt für Schritt Mehrwerte liefert.
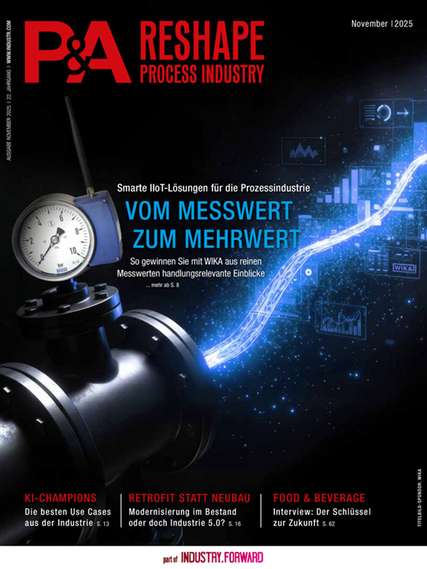














.jpg)

