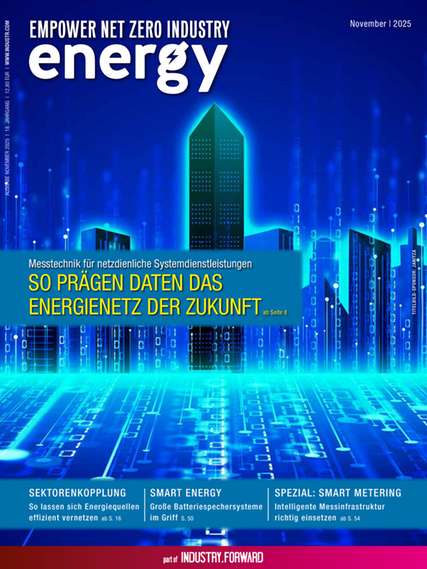Das Schweizer Bauunternehmen Walo Bertschinger hat zwei Hybridspeichersysteme des Herstellers Atlas Copco in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus klassischen Stromerzeugern und leistungsstarken Batteriespeichern. Die Anlagen speichern den erzeugten Strom und geben ihn bedarfsgerecht ab. Die Batterien sind außerdem mit Photovoltaikmodulen ausgestattet und erzeugen bei gutem Wetter zusätzlichen Strom, der mindestens für den Stand-by-Betrieb der Anlagen ausreicht und ansonsten gespeichert wird.
Die Hybridspeicher wurden von Walo Bertschinger in Dietikon erworben. Das Totalunternehmen ist in sämtlichen Märkten der Baubranche tätig, hat aber vor allem Schwerpunktaktivitäten im Straßen- und im Gleisbau.„Wir setzen die Hybridsysteme für den Bau eines längeren Autobahnabschnitts zwischen Thun und Spiez ein, der voraussichtlich 2027 oder 2028 fertiggestellt wird“, berichtet Björn Faes, Leiter Elektrotechnik bei Walo. Da große Teile der Strecke durch Wald führen, sei ein konventioneller Stromanschluss nicht verfügbar, jedoch werde auf der Baustelle Strom für zahlreiche Anwendungen benötigt. „Wir hatten die Wahl: Generatoren oder eben Hybridsysteme.“
Elektrische Pumpen für Regenwasser
Ursprünglich war die Verwendung klassischer Stromerzeuger geplant. Doch angesichts des hauptsächlichen Anwendungsbereichs, der Wasserhaltung, wäre dieser nicht sehr effizient gewesen. „Wir benötigen Strom für elektrische Pumpen, um Regenwasser von der Baustelle abzuleiten“, erklärt Faes. Da Regen zumeist nicht planbar ist und in unterschiedlichen Mengen fällt, wäre auch die Auslastung der Stromerzeuger sehr schwankend gewesen.
In der geplanten dreijährigen Bauzeit wäre der Leerlauf eher die Regel als die Ausnahme gewesen – mit negativen Folgen für die Umwelt, die Lebensdauer der Motoren, die Wartung und die Logistik. Denn Leerlauf ist ineffizient und führt zu höherem Verschleiß, einem erhöhten Wartungsbedarf sowie möglichen Problemen, wie beispielsweise zugesetzten Partikelfiltern. Dagegen läuft der Motor eines Generators, der Teil eines Hybridsystems ist, sehr viel seltener und immer effizient in seinem optimalen Drehzahlbereich.
Einsparungen bei Kraftstoff, Logistik, Wartung und CO2
Nach ersten Recherchen, Gesprächen und Kalkulationen zu den Hybridsystemen von Atlas Copco erkannte Faes schnell das Potenzial der neuen Technik, insbesondere im Hinblick auf die lange Einsatzdauer und die kalkulierte Amortisationszeit von zwei bis drei Jahren. „Wir sparen damit eine erhebliche Menge an Kraftstoff ein, senken den logistischen Aufwand sowie die Kosten für Betankung und Wartung. Zudem reduzieren wir den CO2-Ausstoß, was unserer Nachhaltigkeitsphilosophie entspricht.“
Bei dem Stromerzeuger ist alle 500 Betriebsstunden ein Öl- und Filterwechsel nötig. Da das Hybridsystem die Maschine aber viel weniger laufen lässt, werden die mit der Wartung verbundenen Stillstandszeiten ebenfalls weitgehend vermieden. Ein weiterer Vorteil ist die geringere Lärmbelastung, da die Maschine seltener anspringt. „Die Entscheidung fiel daher recht schnell“, resümiert Faes.
Da gleichzeitig in mehreren Teilabschnitten der Autobahn gearbeitet werden sollte, investierte Walo direkt in zwei Hybridspeicher, die jeweils für längere Zeit an einem Ort verbleiben können. „Nach nur wenigen Monaten kann ich schon sagen: Die Systeme rechnen sich eindeutig! Allein im ersten Quartal dieses Jahres haben wir bereits 6.000 l Diesel eingespart, obwohl die Anlage kaum laufen musste“, berichtet Faes. Laut Atlas Copco lassen sich – abhängig von der Auslastung – Einsparungen von 80 bis 90 Prozent gegenüber dem Betrieb eines Stand-alone-Stromerzeugers erzielen.
„Mit den Hybridspeichern von Atlas Copco sparen wir eine erhebliche Menge an Kraftstoff ein, senken den logistischen Aufwand sowie die Kosten für Betankung und Wartung. Zudem reduzieren wir den CO2-Ausstoß, was unserer Nachhaltigkeitsphilosophie entspricht“, so Björn Faes, Leiter Elektrotechnik bei Walo Bertschinger.
Nicht in jedem Fall überlegen – aber in vielen
Nun könnte man meinen, ein herkömmlicher Stromerzeuger ließe sich bei fehlendem Stromverbrauch einfach abschalten. In der Praxis sei das auf einer über 10 km langen Baustelle wie zwischen Thun und Spiez jedoch „völlig unrealistisch“, entgegnet Faes: „Es müsste ständig jemand zum Generator fahren, um ihn an- oder auszuschalten. Zudem wäre das Abschalten bei wechselhaftem Wetter unsicher und könnte den Betrieb aufhalten, wenn es dann doch wieder anfängt zu regnen.“
Das System lohne sich besonders auf Baustellen, auf denen ein herkömmlicher Stromerzeuger ununterbrochen laufen müsste, die Leistungsabnahme aber extrem variabel wäre. Dann entstünden lange Leerlaufzeiten und die Maschine wäre für die meisten Bedarfe viel zu groß. „In solchen Fällen ist das Hybridsystem die ideale Lösung“, sagt Laurent Houmard, Experte bei Atlas Copco. „Ein Stromerzeuger müsste bei diesem Bedarfsprofil auf den Spitzenverbrauch – zum Beispiel den Betrieb eines Krans, wenn dieser Lasten anhebt – ausgelegt sein, obwohl dieser nur sporadisch auftritt.“ Mit den Hybridsystemen lassen sich in Zukunft auch die Netzanschlüsse auf Baustellen kleiner dimensionieren. Dadurch können Bauherren die Energiekosten für den temporären Baustrom minimieren.
Zwar ist die Anfangsinvestition rund drei- bis viermal so hoch wie bei einem reinen Stromerzeuger, doch die Systeme amortisieren sich laut Björn Faes wie geplant binnen zwei bis drei Jahren. „Die Vorteile überwiegen so deutlich, dass wir bereits über weitere Anschaffungen nachdenken“, betont der Elektrotechniker. „Unser Ziel ist es, zukünftig komplett auf Dieselgeneratoren zu verzichten.“ Früher habe man häufig Generatoren gemietet, was zwar wirtschaftlicher war als ein Kauf, aber stets vermieden werden sollte. Beim Hybridsystem hingegen rechne sich die Investition.
Technik mit Potenzial
Doch wie funktioniert ein Hybridspeicher eigentlich? Ähnlich wie bei einem Stand-alone-Stromerzeuger werden die elektrischen Baugeräte einfach an die Anlage angeschlossen. In diesem Fall beziehen sie ihre Energie jedoch aus der Batterie statt aus dem Generator. Erst wenn der Ladezustand des Speichers unter ein bestimmtes Niveau sinkt, springt der Stromerzeuger automatisch an und lädt den Speicher wieder auf. Der Anwender merkt davon nichts.
Die Ladeleistung ist steuerbar, sodass der Motor des Stromerzeugers stets im optimalen Lastbereich läuft und die richtige Betriebstemperatur erreicht. Das schont die Technik. Die Lade- und Steuerlogik stammt von Atlas Copco, kann aber bei Bedarf vom Anwender angepasst werden. „Das ist aber gar nicht nötig“, findet Faes. Die Bedienung sei denkbar einfach: „Unsere Mitarbeiter müssen nur einen Knopf zum Einschalten drücken – mehr ist nicht nötig.“ Laurent Houmard ergänzt: „Auch den Anschluss der Pumpen haben wir laienfreundlich gestaltet – es wird kein Elektriker benötigt!” Die Einweisung in die gesamte Anlage dauert lediglich eine halbe Stunde, damit die Mitarbeiter im Störungsfall wissen, wie das Bedien-Display funktioniert und schnell reagieren können.
Ein weiterer Vorteil ist die integrierte Solarstromnutzung. „Unsere Energiespeicher verfügen über eigene Photovoltaikmodule, die zumindest den Stand-by-Betrieb abdecken“, erklärt Houmard. Bei entsprechender Fläche können zusätzlich externe Solarpanels angeschlossen werden, was einen weiteren Schritt in Richtung Unabhängigkeit vom Kraftstoffbetrieb darstellt.
Atlas Copco sieht sich mit seinen Hybridspeichern gut aufgestellt. „Die Systeme stärken unser Profil als Anbieter nachhaltiger und innovativer Lösungen“, sagt Country Manager Laurent Houmard. Geringe CO2-Emissionen auf der Baustelle und niedrigere Lebenszykluskosten sind entscheidende Verkaufsargumente. Gerade in Europa sieht der Experte großes Potenzial: „Die klassischen Dieselgeneratoren werden mittelfristig verschwinden“, ist er sich sicher. Dort, wo die Stromlast nicht exakt vorhersehbar ist, liegt die Zukunft bei Hybridsystemen – oder sogar bei reinen Batteriespeichern. Auch als Notstrom-Backup sind die Systeme attraktiv, da sie sich innerhalb von nur 20 ms ans Stromnetz koppeln lassen. Das macht sie auch für Netzbetreiber interessant.
Kombination von Hybridspeicher mit Schnellladestationen
Eine interessante Ergänzung zu den Hybridspeichern sind die Schnellladestationen der FCP-Baureihe von Atlas Copco. Diese Lösungen vereinfachen den Einsatz von elektrisch angetriebenen Baumaschinen wie Radladern oder Baggern, indem sie den Ladevorgang durch eine Spannungserhöhung beschleunigen. Das mobile Ladegerät entlädt den ZBC-Energiespeicher des Hybridspeichersystems besonders zügig, um die elektrischen Baumaschinen im Bedarfsfall noch schneller mit Energie zu versorgen.
Es stehen zwei Ladestationen mit 160 und 240 kW Nennleistung zur Verfügung. Bereits das kleinere Modell, der FCP 160, lädt die Batterien von schweren Elektrofahrzeugen oder -maschinen siebenmal schneller als eine herkömmliche Wallbox und 42 Mal schneller als ein normales Wandladegerät. Das 240-kW-Modell lädt elfmal schneller als die Wallbox und 63 Mal schneller als das Wandladegerät.