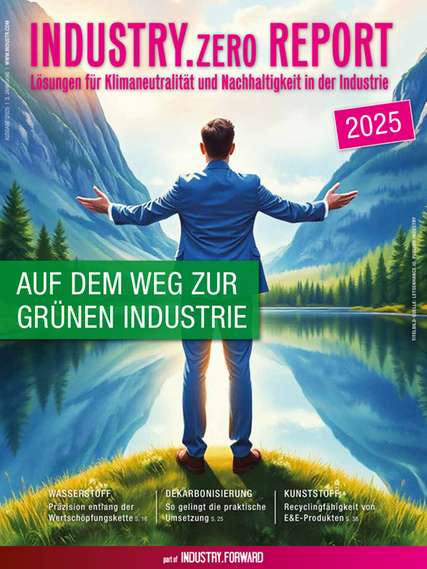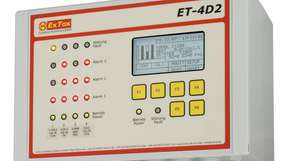Für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft sind große Mengen Wasserstoff aus möglichst erneuerbaren Quellen erforderlich, um die fossilen Energieträger Erdgas, Erdöl und Kohle in den Bereichen Energie, Mobilität und Industrie zu ersetzen. Eine weitere elementare Voraussetzung ist die entsprechende Infrastruktur, um diesen Wasserstoff zu speichern, zu transportieren und zu verteilen. Nur mit beidem kann dieser Umstieg gelingen, der Deutschland und Europa unabhängiger von äußeren Einflüssen macht und das Klima weniger belastet.
Was Speicher und Infrastruktur betrifft, kann Deutschland vor allem auf bestehende Strukturen aufbauen. Das Gasnetz mit 40.000 km Fernleitungen und einem 550.000 km langen Verteilnetz ist 45-mal so lang wie alle Autobahnen zusammen. Auch bei ober- und unterirdischen Gasspeichern ist Deutschland führend. Eine wichtige Rolle können zudem Salzkavernen spielen, um große Mengen Wasserstoff zu speichern. Im Interview erklärt Prof. Carsten Agert, Direktor des Instituts für Vernetzte Energiesysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), unter anderem, was es mit Kavernen-Speichern auf sich hat und wie sich die bestehende Infrastruktur für den Start in die Wasserstoffwirtschaft nutzen lässt.
Was sind Salzkavernenspeicher und wie funktionieren sie?
Prof. Carsten Agert
Salzkavernen sind künstlich geschaffene Hohlräume tief in Salzgestein. Sie entstehen, wenn das dort vorhandene Steinsalz per Tiefbohrung ausgespült wird. Zurück bleibt ein geschlossener, dichter Hohlraum, sozusagen ein riesiger unterirdischer Tank, mit einer Höhe von 300 bis 500 m und einem Durchmesser von 60 bis 80 m. Salzkavernen werden bereits seit Jahrzehnten genutzt, um große Mengen an Erdöl oder Erdgas für mehrere Monate zu speichern. Das ist ein bewährtes und sicheres Verfahren.
Warum eignen sich Salzkavernen besonders fürs Speichern von Wasserstoff?
Prof. Carsten Agert
Teil unserer aktuellen Energie-Forschung am DLR ist es, gemeinsam mit der Industrie zu untersuchen, inwieweit sich Erdgasspeicher in Wasserstoffspeicher umwidmen lassen. Derzeit gibt es deutschlandweit 240 bis 250 Kavernen, in denen Erdgas gespeichert wird. Sie eignen sich potenziell auch für Wasserstoff. Das würde die Kosten und den Zeitaufwand, neue Speicher zu errichten, erheblich reduzieren. Der Bau einer neuen Kaverne dauert rund sieben bis acht Jahre – abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und Planungsverfahren. Die Umstellung von Kavernen auf Wasserstoff stellt uns im Detail vor technische Herausforderungen: Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Eigenschaften von Wasserstoff und Erdgas müssten zum Beispiel Komponenten wie Ventile oder Dichtungen angepasst werden. Gleiches gilt für Anlagen zum Aufreinigen des Gases und Verdichterstationen. Im Wesentlichen können wir jedoch vorhandenes Know-how und weite Teile der bestehenden Infrastrukturen weiternutzen.
Weshalb brauchen wir diese Art von Wasserstoffspeichern überhaupt?
Prof. Carsten Agert
Die Erzeugung von Wasserstoff durch Elektrolyse und mit Strom aus erneuerbaren Energien wird größtenteils zeitlich versetzt zum Bedarf bei den Verbrauchern erfolgen. Daher ist ein Wasserstoff-Gesamtsystem rund um ein Kernnetz ohne Speicherkavernen im Grunde nicht betreibbar. Zudem bieten nur Kavernen die nötigen Speicherkapazitäten, zum Beispiel wenn per Schiff große Mengen an importiertem Wasserstoff angeliefert würden. Für den zukünftigen Speicherbedarf in einer Wasserstoffwirtschaft werden darüber hinaus wahrscheinlich noch weitere Salzkavernen erschlossen werden müssen. Dazu passt: Der Norden Deutschlands weist europaweit das mit Abstand größte Vorkommen an unterirdischen Salzstöcken auf. Sie sind die Grundvoraussetzung, um künstliche Kavernen anzulegen. In Bezug auf die geologischen Gegebenheiten hat Deutschland damit gegenüber seinen Nachbarländern einen großen Standortvorteil. Und wir wären gut beraten, diesen Vorteil volkswirtschaftlich auch zu nutzen.
Welche Herausforderungen bei Kavernenspeichern gilt es noch zu lösen und wie trägt die DLR-Forschung dazu bei?
Prof. Carsten Agert
Die Wasserstoffqualität ist für die Verbraucher ein wichtiger Faktor. Sie variiert bereits vor dem Speichern in einer Kaverne und ist abhängig vom Produktions- und Transportverfahren. Im Forschungsprojekt HyCAVmobil haben wir mit dem Unternehmen EWE Gasspeicher zusammengearbeitet, das im brandenburgischen Rüdersdorf eine neu angelegt Test-Kaverne betreibt. Wir haben unsere Spuren-Gas-Analytik weiterentwickelt und so Wasserstoffproben untersucht, die höchste Reinheitsansprüche erfüllen müssen. Die Ergebnisse unserer Analysen haben dazu beigetragen, dass die Anzahl der erforderlichen Komponenten in der Gas-Aufreinigung in Zukunft reduziert werden kann. Dadurch lassen sich die Investitionskosten erheblich senken. Die Umwidmung von Erdgaskavernen zu Wasserstoffspeichern untersucht das DLR in den Projekten H2CAST-Ready und H2CAST-Prove. Wir simulieren und testen am Computer zum Beispiel eine bestehende Kaverne im niedersächsischen Etzel einschließlich des angeschlossenen Gasnetzes. Außerdem haben wir auch ein dynamisches Modell für das deutsche Wasserstoff-Kernnetz entwickelt. Mit ihm lässt sich der Betrieb zukünftiger Kavernen durch eine mathematische Beschreibung genau analysieren. Ergänzend begleitet unser Projektteam vor Ort den Aufbau von Anlagen an der Oberfläche.
Wie greifen Speicher und Kernnetz in einer zukünftigen Wasserstoffwirtschaft zusammen?
Prof. Carsten Agert
Beim deutschen Wasserstoffkernnetz handelt es sich um das größte geplante Wasserstoffnetz Europas. Seine wesentliche Funktion besteht darin, die Standorte, an denen in Deutschland Wasserstoff erzeugt, gespeichert und verbraucht wird, zu verbinden. Es soll bis zum Jahr 2032 durch die Ferngas-Netzbetreiber fertig gestellt werden und eine Gesamtlänge von rund 9.000 km umfassen. Geplant ist in diesem Zusammenhang, auch einen Teil der bestehenden Erdgas-Infrastruktur umzuwidmen und für das Wasserstoffkernnetz weiter zu nutzen. Das Kernnetz wird zu rund 60 Prozent aus solchen Leitungen bestehen. Und wie schon gesagt: Das Wasserstoff-Gesamtsystem rund um das Kernnetz ist ohne Speicherkavernen nicht wirklich betreibbar, da Wasserstofferzeugung und -verbrauch nicht synchron erfolgen und entsprechend auf Pufferung angewiesen sein werden.
Von welchen Mengen an Wasserstoff sprechen wir im Kontext einer Wasserstoffwirtschaft?
Prof. Carsten Agert
Je nach Szenario erwarten wir in Deutschland für 2045 einen Wasserstoffbedarf von mehreren hundert Terrawattstunden pro Jahr. Im Detail müssen wir dabei zwischen den Verwendungszwecken unterscheiden: Bereits heute benötigt die Industrie große Mengen Wasserstoff, der oft direkt vor Ort aus Erdgas gewonnen wird. Das ist mit der vorhandenen Erdgas-Infrastruktur leicht zu realisieren. Sollen diese und weitere große Verbraucher wie zum Beispiel die Stahlindustrie, Raffinerien und Back-Up-Kraftwerke mit grünem Wasserstoff aus dem Kernnetz versorgt werden, steigt der Gesamtbedarf rasant. Damit das Wasserstoffkernnetz zu Beginn stabil ins Laufen kommt, werden Speicherkapazitäten von rund fünf TWh nötig sein. Das ist vergleichsweise wenig, aber für das Funktionieren des Netzes – nicht nur zum Start – essenziell. Langfristig erwarten wir für Deutschland einen Wasserstoff-Speicherbedarf von ungefähr 40 bis 80 TWh. Durch das Umwidmen von Erdgasspeichern und den Bau neuer Kavernen lassen sich diese Zielwerte nach heutigem Stand auch erreichen.
Wie würde sich der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft auf den Standort Deutschland und seine Industrien auswirken?
Prof. Carsten Agert
Eine funktionierende europäische Wasserstoffwirtschaft macht die deutsche Industrie resilienter gegen äußere Einflüsse – aus sicherheitspolitischer und auch aus geostrategischer Sicht. Mit ihrem Aufbau verringern wir für die deutsche Industrie schrittweise die Abhängigkeit von Öl-, Gas- und Kohle-Importen. Nicht nur aufgrund des Klimawandels führt deshalb langfristig kein Weg daran vorbei, das Land und seine Industrie auf grünen Strom, Wasserstoff und Wasserstoff-Derivate wie Ammoniak und erneuerbare Kraftstoffe umzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft im Sinne von Sicherheit, Unabhängigkeit, dem Erhalt von Arbeitsplätzen und nachhaltigem Wohlstand handeln.
Welche Entwicklungen braucht es, um in eine Wasserstoffwirtschaft zu starten?
Prof. Carsten Agert
Zunächst müssen wir die Erzeugung von Wasserstoff günstiger machen. Die derzeitige Regulatorik – insbesondere auf europäischer Ebene – verteuert ein Produkt ganz erheblich, das es auf dem Weg in den Markt ohnehin schon schwer hat. Parallel dazu ist es wichtig, nicht nur auf die Angebots- und Infrastrukturaspekte zu schauen, sondern auch die Seite von Abnehmern und Kunden aktiv zu unterstützen. Aus heutiger Sicht sind das primär die Stahl- und Chemie-Industrie sowie Raffinerien und Prozessindustrie mit Bedarf an Hochtemperaturwärme, ergänzt um Backup-Kraftwerke im Stromsektor sowie die Erzeugung nachhaltiger Kraftstoffe.