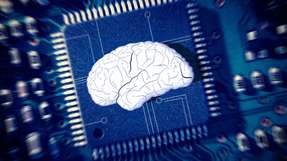Dem Erfinder der direkten Elektrolyt-Dichtheitsprüfung für Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batteriezellen ist es gelungen, die Empfindlichkeit dieses Verfahrens um den Faktor zehn zu steigern. Jetzt lässt sich mit der Methode gegen eine Grenzleckrate von 5 x 10-8 mbar∙l/s testen. Dies eröffnet der industriellen Dichtheitsprüfung eine Reihe neuer Möglichkeiten. Anwender können jetzt um rund 30 Prozent schneller prüfen als bisher – um ihren Durchsatz in der Linie nochmals zu erhöhen.
Zudem gestattet es die höhere Empfindlichkeit, auch in größeren Vakuumkammern zu prüfen. Das heißt, die Methode ist nicht mehr auf Chargen von vielleicht 32 Batteriezellen beschränkt – sie eignet sich jetzt ebenso für die Prüfung größerer, fertig zusammengebauter Batteriemodule. Sogar für die zukünftigen Semi-Solid-State-Batterien mit ihrem gelartigen Elektrolyt ist die Methode dank der höheren Empfindlichkeit nun gerüstet. Denn selbst wenn aus Lecks in der Zelle statt einer Flüssigkeit ein viskoses Gel austritt, wird die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung dies zuverlässig nachweisen.
Lithium-Ionen oder Natrium-Ionen-Batteriezellen müssen ihre Dichtheit über viele Jahre bewahren. Lecks im Zellgehäuse könnten dazu führen, dass Elektrolyt aus der Batteriezelle austritt, sodass sie an Kapazität verliert. Ebenso darf keine Luftfeuchtigkeit in die Zelle eindringen, denn Wasser würde mit dem Elektrolyten zu ätzender Flusssäure reagieren – sodass noch mehr Lecks entstehen, was die Kapazität weiter reduziert. Die Herausforderung bei der Fertigung der Batteriezellen besteht allerdings darin, dass eine Dichtheitsprüfung besonders dann unerlässlich ist, wenn die Gehäuse bereits mit flüssigem Elektrolyt befüllt worden sind. Nur scheitern hier alle herkömmlichen Dichtheitsprüfverfahren.
Herkömmliche Prüfverfahren stoßen an ihre Grenzen
In diesem speziellen Anwendungsszenario der Prüfung befüllter Zellen ist auch eine grundsätzlich sehr empfindliche Methode wie das Helium-Bombing ungeeignet. Beim Helium-Bombing wird ein Prüfteil zunächst einer Helium-Atmosphäre ausgesetzt, sodass das Helium durch etwaige Lecks in das Prüfteil eindringen kann. Anschließend stellt man in einer Vakuumprüfkammer fest, ob gegebenenfalls durch Lecks eingedrungenes Helium-Prüfgas durch diese Lecks auch wieder austritt. Weil aber sowohl Lithium-Ionen als auch Natrium-Ionen-Zellen mit einem flüssigen Elektrolyten befüllt sind, ist es wahrscheinlich, dass das Helium-Prüfgas in der Zelle einfach nach oben steigt und der flüssige Elektrolyt das Leck blockiert. Und weil das Prüfgas dann nicht aus dem Zellgehäuse austreten kann, lässt es sich in der Vakuumkammer auch nicht nachweisen. Das grundsätzlich sehr empfindliche Helium-Bombing eignet sich also nicht für Prüfteile, die mit Flüssigkeiten befüllt sind, wie beispielsweise Batteriezellen.
Die Elektrolyt-Lösungsmittel fungieren als Prüfgas
Die Lösung, die der Dichtheitsprüfspezialist Inficon aus Köln für das Problem der Prüfung befüllter Batteriezellen entwickelt hat, besteht darin, kurzerhand den flüssigen Elektrolyten selbst als Prüfgas zu nutzen – genauer gesagt: das Elektrolyt-Lösungsmittel in der Zelle. Wenn dieses durch ein Leck in das Vakuum einer Prüfkammer austritt, wird es sofort gasförmig, sodass das Massenspektrometer des Prüfgeräts es nachweisen kann.
Die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung hat sich nun seit einigen Jahren bewährt, in Batteriefertigungslinien in Europa ebenso wie in Fertigungsanlagen in China. Das allererste Gerät, das die patentierte direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung nutzt – Inficon hat es 2019 vorgestellt –, verfügt über eine Steuereinheit für die Gasflüsse. Damit eignet es sich auch für den Stand-alone-Betrieb, etwa bei der Dichtheitsprüfung in der Prototypen-Entwicklung. Das neueste Gerät namens ELT Vmax hat Inficon dagegen speziell für den Einsatz in industriellen Fertigungslinien und für den Einbau in automatisierte Prüfanlagen konzipiert.
Die einzige Methode für Prüfungen nach dem Befüllen und nach dem Formieren
Grundsätzlich existieren Zellgehäuse für Lithium-Ionen und Natrium-Ionen-Batterien in drei Bauformen. Es gibt Zellen mit starrem Gehäuse – dies sind prismatische oder Rundzellen –, und es gibt Pouchzellen mit weichem, beutelartigem Gehäuse. Es hängt von der Bauform ab, an welchen Stellen im Fertigungsprozess der Zellen Dichtheitsprüfungen sinnvoll und möglich sind.
Bei allen Zellen mit festen Gehäusen bietet es sich an, die Gehäuse schon vor dem Befüllen mit Elektrolyten erstmals auf ihre Dichtheit zu testen. Hierzu füllt man die Gehäuse mit Helium-Prüfgas und ermittelt anschließend in einer Vakuumkammer, ob und wie viel Helium aus der Zelle durch ein etwaiges Leck austritt: eine Helium-Vakuumprüfung. Für den zweiten Dichtheitsprüfungsschritt – nach dem Befüllen und Versiegeln der Batteriezelle – eignet sich dann nur noch die Methode der direkten Elektrolyt-Dichtheitsprüfung. Um sicherzustellen, dass die Zelle auch nach dem anschließenden Fertigungsschritt der Formierung noch dicht ist, empfiehlt es sich, die Elektrolyt-Dichtheitsprüfung ein zweites Mal anzuwenden.
Pouchzellen lassen sich nur so prüfen
Aktuell werden die Pouchzellen mit ihren beutelartigen Gehäusen wieder beliebter. Vor der Entwicklung der direkten Elektrolyt-Dichtheitsprüfung existierte gar keine sinnvolle Methode, um diese weichen Gehäuse auf ihre Dichtheit zu testen. Denn ihre endgültige Form erhält eine Pouchzelle erst, wenn sie formiert und versiegelt worden ist. Zuvor ist an der Pouchzelle noch ein Sack angebracht, der beim Formieren entstehendes Gas auffängt. Erst durch das Abtrennen dieses Sacks erhält die weiche Pouchzelle ihre abschließende Gestalt, und erst dann wird sie endgültig versiegelt. Das bedeutet: Ganz grundsätzlich ist eine aussagefähige Dichtheitsprüfung an einer Pouchzelle erst nach dem Fertigungsschritt des Formierens und Versiegelns möglich – mit der Elektrolyt-Dichtheitsprüfung als einzigem dafür geeigneten Verfahren.
Prüfen im Takt der Produktion
Inficon hatte seinen ELT Vmax von Anfang an auf einen hohen Durchsatz in der Linie hin entwickelt. Das Prüfgerät ist dazu konzipiert, in automatisierte Prüfanlagen mit mehreren Prüfkammern integriert zu werden. Auf diese Weise lassen sich im Prüfprozess Wartezeiten des Geräts bei der Evakuierung und Belüftung einer einzelnen Prüfkammer vermeiden. Wird das Gerät mit mehreren Kammern betrieben, kann es sich praktisch ständig im Prüfbetrieb befinden. Ein weiterer Ansatz, um eine Qualitätssicherung im Takt der Produktion zu gewährleisten, besteht darin, anstelle von einzelnen Zellen immer mehrere Zellen gleichzeitig in der Prüfkammer zu testen. Die Anzahl von Zellen in einer Charge ist dabei oft eine 2er-Potenz, wie etwa 16, 32 oder 64. Denn sollte eine Charge beim Batch-Testing durchfallen, muss sie für die dann erforderlichen Nachprüfungen immer weiter geteilt werden können – in diesem Fall halbiert. Dies geschieht so lange, bis die undichte Zelle in einem Batch der Größe 1 identifiziert ist.
Die abgespeckte Hardware führt zu höherer Empfindlichkeit und Geschwindigkeit
Die erste Generation des ELT Vmax gestattete Prüfungen gegen eine kleinste Grenzleckrate von 5 x 10-7 mbar∙l/s. Mit einer neu entwickelten Firmware konnte diese Empfindlichkeit nun um den Faktor 10 gesteigert werden: auf 5 x 10-8 mbar∙l/s. Die neue Firmware arbeitet mit einer verbesserten Sensoransteuerung und macht sich zugleich die Tatsache zunutze, dass das kompakte, für den Einbau in 19-Zoll-Racks vorgesehene Prüfgerät kleinere interne Totvolumina aufweist als sein größerer Stand-alone-Bruder.
Hinzu kommt die hohe Linearität, mit der das Gerät austretendes Elektrolytlösungsmittel detektiert. So kann der Auswertungsalgorithmus schon früh den Signalanstieg extrapolieren und die Leckrate dadurch schneller bestimmen. Die neuentwickelte Firmware nutzt die Möglichkeiten, die hier die Hardware mitbringt, aus. Bei der industriellen Prüfung von Lithium-Ionen und Natrium-Ionen-Batteriezellen arbeitet die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung typischerweise in einem Leckratenbereich von ungefähr 10-6 mbar∙l/s. Mit seiner zehnfach höheren Empfindlichkeit und der neuen Firmware prüft das weiterentwickelte Gerät die Batteriezellen nun faktisch 30 Prozent schneller: Statt 10 bis 11 Sekunden dauert der Messyklus bei den Grenzleckraten, die für Batteriezellen typisch sind, jetzt nur noch 7 bis 8 Sekunden.
Ganze Batteriemodule in einer großen Kammer prüfen
Ein Prüfgerät mit höherer Empfindlichkeit kann also auch dazu dienen, gegen die bisherigen Leckraten schneller zu prüfen als bisher. Eine weitere interessante Option, die eine höhere Empfindlichkeit eröffnet, ist die Prüfung in einer größeren Vakuumkammer – also ein Test an größeren Prüfteilen. Denn wie klein bei einer Dichtheitsprüfung die kleinste nachweisbare Leckrate ist, hängt immer auch von der verwendeten Prüfkammer ab. Der Zusammenhang ist einfach: Je größer das Totvolumen der Prüfkammer – also der freie Raum um das Prüfteil –, desto größer fällt die kleinste nachweisbare Leckrate in dieser Kammer aus.
Dies bedeutet wiederum: Ein Prüfgerät mit zehnfach höherer Empfindlichkeit kann in einer großen Kammer mit einem zehnfach größeren Totvolumen dieselbe Grenzleckrate prüfen, die ein weniger empfindliches Prüfgerät nur in einer kleineren Prüfkammer erreicht. Durch diese Eignung auch für größere Prüfkammern wird die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung nun zur ersten Methode, die geeignet ist, die Dichtheit von Zellen auch noch nach deren Zusammenbau zu Batteriemodulen zu testen – gegen die erforderlichen Grenzleckraten im Bereich von 10-6 mbar∙l/s.
Damit auch die zusammengeschweißten Zellen in Batteriemodulen noch dicht sind
Bisher gab es kein Verfahren, mit dem sich nach dem Zusammenbau der Batteriemodule, die oft einige Dutzend Batteriezellen enthalten, noch hätte prüfen lassen, ob einzelne Zellen bei der Montage vielleicht Lecks davongetragen haben. Die einzelnen Batteriezellen in einem Batteriemodul müssen in Parallel- oder in Reihenschaltung miteinander verbunden werden – dafür werden sie über eine Sammelschiene (englisch Busbar) aneinandergekoppelt. Die Busbar wird fest mit den Elektrokontakten jeder einzelnen Zelle verschweißt. Es ist vor allem dieser Schweißprozess, der die Gefahr birgt, die Zellgehäuse zu beschädigen. Bei den weichen Pouchzellen ist das Beschädigungsrisiko besonders ausgeprägt. Ob der Fertigungsschritt des Festschweißens unbeabsichtigt zu Lecks in den Zellen geführt hat, ließ sich bisher nicht zuverlässig testen. Erst die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung eröffnet nun diese Möglichkeit.
Aus Semi-Solid-State-Zellen austretenden, gelartigen Elektrolyten detektieren
Bislang weisen von den Lithium-Ionen-Zellen, die üblicherweise für die Elektromobilität eingesetzt werden, die Typen NCA (Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Oxid) und NMC (Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid) die wohl höchsten Energiedichten auf, mit bis zu 250 oder sogar 260 Wh/kg. Für zukünftige Semi-Solid-State-Batterien mit Lithium-Ionen-Technologie versprechen Forschungsergebnisse dagegen Energiedichten im Bereich von 300 bis 500 Wh/kg. Semi-Solid-State-Batterien – auch Halbfestkörperbatterien genannt – verdanken ihren Namen der Tatsache, dass der Elektrolyt in ihnen nicht mehr flüssig, sondern gelartig ist. Durch diese neue Batterietechnologie verdoppelt sich nicht nur die Energiedichte, die neuen Batterien haben bei Schnellladevorgängen auch nicht mehr mit Überhitzungsproblemen zu kämpfen.
Doch auch bei Semi-Solid-State-Batterien gilt: Voraussetzung für eine lange Lebensdauer ist, dass sie dicht genug sind, um den Elektrolyt- und Kapazitätsverlust auf ein Minimum zu begrenzen. Ein Elektrolyt mit gelartiger Konsistenz tritt während einer Dichtheitsprüfung in der Vakuumkammer natürlich langsamer aus einem etwaigen Leck im Zellgehäuse aus. Aber auch hier spielt die neueste Generation der Geräte für die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung wieder den Vorteil ihrer Empfindlichkeit aus. Denn diese sehr hohe Empfindlichkeit gestattet es, auch bei Semi-Solid-State-Zellen schnell alle Lecks mit einer kritischen Größe zu identifizieren. Und zwar wie gewohnt: im Takt der Produktion.
Erweitere Möglichkeiten der Qualitätssicherung in der Batteriefertigung
Die jetzt zehnfach höhere Empfindlichkeit der direkten Elektrolyt-Dichtheitsprüfung bedeutet sowohl einen quantitativen als auch einen qualitativen Sprung für die Qualitätssicherung in der Batterieherstellung. Schon die um 30 Prozent kürzeren Prüfzyklen sind ein wichtiger Vorzug in der Fertigungslinie. Völlig neu ist die Option, die Zellen – und besonders Pouchzellen – nun auch nach dem Zusammenbau zu Batteriemodulen noch daraufhin prüfen zu können, ob sie beim Fertigungsschritt des Verschweißens intakt geblieben sind. Last but not least: Die direkte Elektrolyt-Dichtheitsprüfung verspricht Zukunftssicherheit. Denn jetzt ist die patentierte Methode empfindlich genug, um mit ihr auch mit Elektrolyt-Gel befüllte Semi-Solid-State-Zellen auf ihre Dichtheit zu testen.