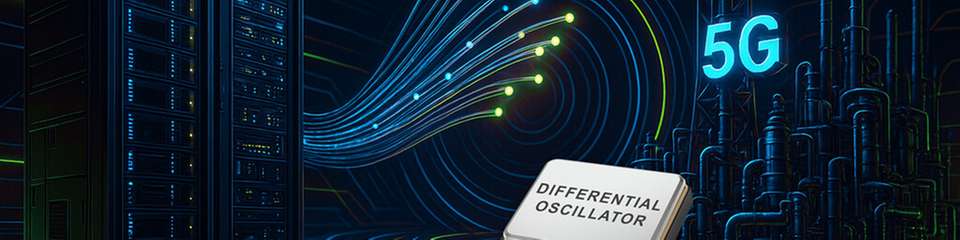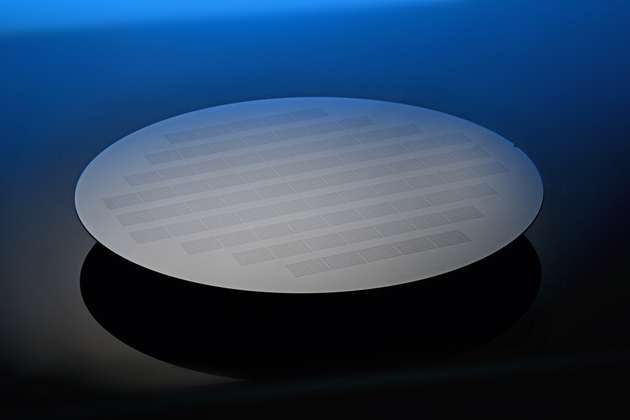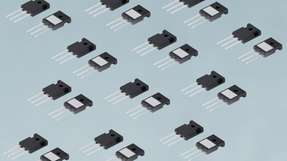Dr. Christian Vedder, wie beurteilen Sie die aktuelle Entwicklung in der Mikroelektronik? Welche Trends sehen Sie als besonders richtungsweisend?
Die Mikroelektronik befindet sich derzeit in einer Phase tiefgreifender Transformation, getrieben durch globale Megatrends wie Digitalisierung, Elektromobilität, Künstliche Intelligenz und Quantentechnologie. Diese Entwicklungen führen zu einem rasant steigenden Bedarf an leistungsfähigeren, kompakteren und gleichzeitig energieeffizienteren Bauelementen. Besonders richtungsweisend sind aktuell Technologien wie Advanced Packaging, Chiplet-Architekturen und 3D-Integration, die eine höhere Funktionalitätsdichte bei gleichzeitig verbesserter thermischer Performance ermöglichen. Auch die Nachfrage nach Halbleitern aus Wide-Bandgap-Materialien wie SiC und GaN nimmt deutlich zu, vor allem im Bereich Leistungselektronik. Parallel dazu gewinnt die nachhaltige Produktion an Relevanz – sowohl aus ökologischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen. Der Markt wird sich künftig noch stärker entlang von Systemlösungen und funktional integrierten Komponenten ausrichten, was enorme Innovationspotenziale, aber auch Investitionsdruck für die Industrie bedeutet.
Welche Rolle spielt das Fraunhofer ILT in diesem sich rasant entwickelnden Technologiefeld?
Unsere Stärke liegt darin, Lasertechnologien für die Fertigung von Mikroelektronik weiterzuentwickeln und praxistauglich zu machen. Wir arbeiten eng mit Partnern aus Industrie und Forschung zusammen und bringen neue Verfahren zur Marktreife – zum Beispiel in der Glas- und Halbleiterstrukturierung, bei Dünnschichtmodifikationen, im Packaging beziehungsweise beim kontaktlosen Fügen. Dabei legen wir großen Wert auf ressourcenschonende, präzise und flexible Lösungen.
Die Miniaturisierung ist ein zentraler Trend in der Mikroelektronik. Wo sehen Sie hier die größten Herausforderungen für Forschung und Industrie?
Miniaturisierung bringt die etablierten Fertigungsprozesse zunehmend an ihre physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen. Auf technischer Ebene stellt vor allem die steigende Packungsdichte enorme Anforderungen an Thermomanagement, Signal- und Leistungsintegrität sowie an die Präzision in der Verbindungstechnik. Gleichzeitig verschiebt sich die Komplexität in Richtung Packaging und Systemintegration. Für die Industrie bedeutet das, dass klassische Skaleneffekte durch neue Materialien, heterogene Integration und 3D-Strukturen ersetzt werden müssen, mit hohen Investitionen in Know-how und Equipment. Für viele Unternehmen wird es immer wichtiger, alternative Technologien wie Laserverfahren zu nutzen, die flexibler und oft günstiger skalierbar sind. Die Herausforderung liegt darin, solche Verfahren stabil und industrietauglich umzusetzen. Forschung und Industrie müssen hier noch enger verzahnt agieren.
Welche technischen Grenzen müssen überwunden werden, um noch kleinere und leistungsfähigere Chips zu entwickeln?
Die größte technische Herausforderung liegt aktuell in der weiteren Skalierung unterhalb von 3 nm – hier stoßen klassische Transistorarchitekturen an physikalische und wirtschaftliche Limits. Neue Ansätze wie Gate-All-Around-FETs, neue Materialien wie 2D-Halbleiter oder Backend-Integration rücken in den Fokus. Gleichzeitig wird die horizontale Miniaturisierung zunehmend durch vertikale Integration ergänzt, etwa durch 3D-Chipstacks und Advanced Packaging.
Wie verändert der steigende Bedarf an energieeffizienten Lösungen den Markt für Mikroelektronik?
Der Energiebedarf von Chips wird zum entscheidenden Kriterium – nicht nur für mobile Geräte, sondern auch für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Dadurch gewinnen neue Architekturen, Materialien und eben auch neue Fertigungsprozesse an Bedeutung. Lasertechnologien helfen hier, weil sie gezielt einzelne Funktionsbereiche bearbeiten und sowohl Energieverluste in der Produktion minimieren als auch die Energieeffizienz im späteren Betrieb steigern können.
In welchen Bereichen der Mikroelektronik werden Lasertechnologien aktuell besonders intensiv genutzt?
Besonders stark nachgefragt sind Laserverfahren dort, wo Präzision, Materialvielfalt und Prozessflexibilität gefragt sind, zum Beispiel in der Strukturierung und Trennung von Wafern, beim Halbleiterannealing oder -kristallisieren, beim Advanced Packaging – etwa für Through-Silicon oder Through-Glas Vias oder das Laser(de)bonding – sowie in der Mikromaterialbearbeitung für Substrate und Leiterbahnen. Auch bei der Herstellung flexibler Elektronik und in der additiven Fertigung elektronischer Komponenten spielen Laserverfahren eine zentrale Rolle. Durch ihre Präzision bei gleichzeitiger Vielseitigkeit lassen sich mit Lasern Verfahren umsetzen, die mechanisch oder chemisch teilweise kaum möglich wären.
Wie trägt das Fraunhofer ILT mit seinen Entwicklungen dazu bei, neue Fertigungsprozesse in der Mikroelektronik zu ermöglichen?
Neben den neuen Lasermaterialbearbeitungsverfahren entwickeln wir ebenfalls die notwendige Lasersystemtechnik – von den optischen Systemen über die Prozesssensorik bis hin zur Anlagenintegration inklusive Steuerung. Dabei haben wir immer die industrielle Nutzung im Blick und erarbeiten so Prototypenanlagen oder auch -bestandteile, die eine Pilotisierung ermöglichen. Beispiele sind die Entwicklung von DUV-UKP-LLO - das Trennen von GaN-Schichten von Trägersubstraten mittels Deep-UV-Ultrakurzpulslaser-Lift-Off zum Beispiel für µLED-Anwendungen oder Leistungselektronik - oder das Herstellen der angesprochenen Through-Vias für die vertikale Integration. Hier werden neuartige Verfahren und optische Systeme benötigt, die präzise und gleichzeitig produktive Verfahren ermöglichen.
Welche Vorteile bieten laserbasierte Verfahren im Vergleich zu konventionellen Technologien, etwa beim Packaging oder der Strukturierung von Halbleitern?
Laser ermöglichen es, Materialien digital punktgenau zu bearbeiten – ohne Masken, ohne chemische Ätzprozesse und – durch Einsatz von Ultrakurzpulslasern – mit sehr wenig thermischem Stress. Durch ihre hohe zeitliche und örtliche Fokussierbarkeit lassen sich auch in sonst transparenten Materialien Bearbeitungen durchführen; dies ermöglicht u.a. fortschrittliche, hochsaubere Wafer-Trennverfahren oder das eben erwähnte Laser-Lift-Off. Mittels LIFT, für Laser-Induced Forward Transfer, lassen sich gezielt Halbleiterschichten oder -strukturen von einem Träger auf einen anderen übertragen; mittels angepasster Intensitätsverteilung ortsgenau amorphe CVD/PVD-Schichten oder nasschemisch deponierte Schichten aus Halbleitermaterialien kristallisieren. Der Laserstrahl lässt sich sogar derart anpassen, dass individuelle Bohr- oder Schnittkantengeometrien erzeugt werden können. Durch entsprechende optische Systemtechnik lassen sich Prozesse in kurzer Zeit umstellen oder individualisieren – ein Riesenvorteil in einer Branche, die immer schneller neue Designs und Produktvarianten hervorbringt.
Welche Rolle spielen Laser beim kontaktlosen Fügen und in der Aufbau- und Verbindungstechnik?
Kontaktlose Fügeverfahren auf Laserbasis sind vor allem dort wichtig, wo klassische Verfahren an ihre Grenzen stoßen – zum Beispiel bei temperaturempfindlichen oder dünnen Substraten oder sehr kleinen Bauteilen. Laserschweißen oder -löten ist hochpräzise, schnell und lässt sich gut automatisieren. In der Aufbau- und Verbindungstechnik setzen wir dabei auf Verfahren wie das Mikroschweißen, LIMBO, mit dem sich dicke Kupferverbindungen auf empfindlichen Substraten fügen lassen – ein Prozess, der bisher kaum zuverlässig möglich war, oder das Glasfritbonden, das besonders für hermetisch dichte Verbindungen genutzt wird. Mittels Digitaldruck- und Laserfunktionalisierung lassen sich metallische Interfaces für Mikroschweiß-, Löt- oder Steckverbindungen herstellen.
Welche Potenziale sehen Sie in der additiven Fertigung für die Integration von Sensorik in elektronische Bauteile?
Die additive Fertigung ermöglicht es, komplexe Strukturen in einem einzigen Schritt herzustellen – und dabei gezielt Funktionselemente wie Sensoren, Heizer- oder Leiterbahnen direkt zu integrieren. Das spart Platz, reduziert Gewicht und vereinfacht die Montage. Darüber hinaus können Sensoren an Orten platziert werden, die vorher nicht denkbar gewesen wären, unmittelbar an der Wirkzone. Besonders spannend ist das für Anwendungen im Leichtbau, in der Medizintechnik oder bei Wearables. Der 3D-Druck von Elektronik steckt zwar noch in der frühen Phase der industriellen Umsetzung, aber wir sehen hier sehr viel Potenzial für individualisierte, multifunktionale Bauteile.
Inwiefern ermöglichen Laserverfahren eine präzisere oder ressourcenschonendere Fertigung von Elektronik-Komponenten?
Laser tragen nur dort Material ab oder fügen es zu, wo es wirklich nötig ist – das macht die Verfahren im ersten Schritt materialeffizienter. Die Kombination neuer DUV-UKP-Laserstrahlquellen mit angepassten optischen Systemen ermöglichen eine immer genauere und – durch den Verzicht auf Hochvakuumverfahren – energieeffizientere Strukturierung. In der weiteren Nutzung der präzise hergestellten Produkte erwarten wir eine weitere Energieeffizienzsteigerung. Außerdem entfällt oft der Einsatz von Chemikalien, was umweltfreundlicher ist. Insbesondere bei der additiven Fertigung spielt der Laser eine zentrale Rolle: etwa beim selektiven Lasersintern und -kristallisieren gedruckter Schichten oder beim laserunterstützten Abscheiden leitfähiger Schichten. So lassen sich Mikrostrukturen massenhaft individualisiert erzeugen, da alle verwendeten Verfahren digital gesteuert werden – und das mit minimalem Materialverbrauch.
Warum haben Sie den Holographic Touch entwickelt? Wie kam es dazu?
Wir beschäftigen uns ständig mit neuen Technologien und der Frage: Was kommt nach dem „Touchscreen“? Es gab allerdings wenige fertige Lösungen, die uns überzeugt haben. Der Holographic Touch war das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit. Unser CTO Rudolf Sosnowsky hat das Potential der Technologie entdeckt und daraus ein neuartiges Produkt entwickelt.
Welche Anwendungen von gedruckter Elektronik halten Sie in den kommenden Jahren für besonders vielversprechend?
Besonders spannend finde ich smarte Bauteile, die ein besseres Verständnis der Belastungsszenarios von Komponenten zulassen und im besten Falle sogar die Möglichkeit zur Maschinenanpassung zu geben, um energieeffizientere Arbeitspunkte zu ermöglichen oder kritische zu vermeiden. Auch gedruckte Sensoren auf flexiblen Trägermaterialien – etwa für smarte Textilien oder medizinische Anwendungen sind interessant, um personalisierte medizintechnische Unterstützung im Alltag zu ermöglichen. Bei der Herstellung von OLEDs, effizienteren Solarzellen oder Dünnschicht-Brennstoffzellen oder -Elektrolyseure für Wasserstoff oder Wasserstoffverbindungen für die Energiewende bieten gedruckte Schichten in Kombination mit Laserverfahren ebenso Vorteile.
Das Fraunhofer ILT arbeitet unter anderem an laserbasiertem Glasfritbonden und Mikroschweißen. Welche neuen Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich dadurch?
Beide Verfahren ermöglichen sehr präzise, lokal begrenzte Fügeverbindungen – bei minimaler thermischer Belastung. Das Glasfritbonden eignet sich ideal für das hermetische Verschließen empfindlicher Mikrosysteme, wie sie etwa in der Sensorik oder Medizintechnik gebraucht werden. Beim Mikroschweißen lassen sich sehr feine metallische Verbindungen erzeugen, etwa für Kontakte auf dünnen Drähten oder filigranen Strukturen in der Leistungselektronik. Diese Verfahren schaffen neue Möglichkeiten, miniaturisierte und gleichzeitig robuste Baugruppen herzustellen.
LIMBO ermöglicht das Fügen dicker Kupferverbinder auf sensiblen Substraten. Welche Branchen profitieren besonders davon?
Besonders die Leistungselektronik und die Elektromobilität profitieren von LIMBO. Dicke Kupferleiter sind wichtig für hohe Ströme – etwa in Wechselrichtern, Ladegeräten oder Batteriemodulen. Gleichzeitig dürfen die darunterliegenden Schichten – zum Beispiel keramische oder polymere Substrate – nicht beschädigt werden. LIMBO löst genau dieses Problem, weil es das Kupfer an den Fügestellen lokal aufschmilzt, ohne das Bauteil insgesamt zu erhitzen. Auch für die Luft- und Raumfahrt oder die Automatisierungstechnik ist das sehr interessant.
Welche Bedeutung hat extreme ultraviolette (EUV) Strahlung für die Weiterentwicklung der Halbleitertechnik?
EUV ist absolut essentiell für die Weiterentwicklung in der Halbleitertechnik – besonders, wenn es um Strukturgrößen weit unterhalb von 10 nm geht. Durch die sehr kurze Wellenlänge der EUV-Strahlung lassen sich viel feinere Details abbilden als mit längerwelligem Licht. Das ist ein riesiger Schritt, bringt aber auch enorme technische Herausforderungen mit sich, etwa bei der Strahlquellenstabilität oder der Optik. Damit trägt EUV wesentlich zur Leistungssteigerung und Energieeffizienz moderner Chips bei, insbesondere für Anwendungen in KI, 5G und High-Performance-Computing.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach die Mikroelektronik durch Fortschritte in der Lasertechnologie in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändern?
Schon jetzt sind Laserverfahren die Herzstücke vieler Mikroelektronikverfahren und werden zukünftig eine Schlüsselrolle in weiteren, neuen Fertigungsprozessen einnehmen, zum Beispiel in der Heterointegration, der Bearbeitung neuer Materialkombinationen et cetera Wir werden deutlich flexiblere und individuellere Produktionsprozesse sehen. Laser ermöglichen es, sehr schnell auf neue Designs und Materialien zu reagieren; sie werden in Kombination mit KI-gestützten Material-, Bauteil- und Prozessentwicklungen herkömmliche Prozess- und Produkt-Ansätze maßgeblich verändern. Gleichzeitig trägt der Laser dazu bei, Ressourcen zu sparen und Prozesse nachhaltiger zu gestalten. Das wird in Zukunft ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.
Welche Rolle spielt das Fraunhofer ILT bei der Entwicklung neuer Lösungen für die Mikroelektronik-Industrie?
Wir verstehen uns als Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrieller Umsetzung. Am Fraunhofer ILT entwickeln wir nicht nur neue Verfahren, sondern begleiten auch aktiv den Transfer in die Fertigung. Dabei bringen wir unser Know-how aus verschiedenen Bereichen zusammen – etwa aus der Lasermaterialbearbeitung, der Optikentwicklung und der Systemtechnik. Unser Ziel ist es, unseren Partnern komplette, anwendungsreife Lösungen zu bieten.
Gibt es aktuelle Forschungsprojekte am ILT, die Sie als besonders zukunftsweisend ansehen?
Einige habe ich bereits erwähnt, zum Beispiel das DUV-UKP-LLO für GaN-Schichten, das LIFT-Verfahren zum Transfer von Mikro-LEDs, das Mikroschweißen, das Laserkristallisieren von nasschemisch abgeschiedenen Halbleitermaterialien et cetera. Für den Bereich der Quantentechnologie ist das Herstellen optoelektronischer Komponenten sehr interessant: Hier werden mittels des sog. SLE, das steht für selektive laser-induced etching, Mikrostrukturen in transparente Träger zum Beispiel Glaswafer eingebracht, die nach einem Ätzbad zu herausgelösten Mikrostrukturen führen, die nach einem weiteren Laserpolierschritt und weiteren Veredelungsschritten als Resonatoren oder Ionenfallen genutzt werden können. Auch sog. PICs, also photonic integrated circuits, werden zukünftig mit vielversprechenden Laserverfahren und angepasster Lasersystemtechnik verbessert.
Wo sehen Sie den größten Innovationsbedarf für die deutsche Mikroelektronik-Industrie, um international wettbewerbsfähig zu bleiben?
Wir müssen schneller werden – nicht nur in der Forschung, sondern vor allem in der Umsetzung. Viele gute Ideen entstehen in Deutschland, aber es dauert oft zu lange, bis sie in der Industrie ankommen. Außerdem brauchen wir mehr Offenheit für neue Materialien, digitale Produktionsprozesse, KI-gestützte Material- und Prozessentwicklung und nachhaltige Technologien. Die Kombination aus Innovationsfreude und industrieller Umsetzungskraft wird entscheidend sein.
Welche Empfehlungen würden Sie Unternehmen geben, die neue Laserprozesse in ihre Fertigung integrieren wollen?
Frühzeitig testen, im kleinen Maßstab starten und offen für neue Denkweisen bleiben. Wer Lasertechnologien sinnvoll einsetzen will, muss oft bestehende Prozesse und Prozessketten überdenken – das ist manchmal unbequem, lohnt sich aber fast immer. Wir unterstützen Unternehmen dabei, den richtigen Einstieg zu finden und begleiten sie auf dem Weg bis dahin.