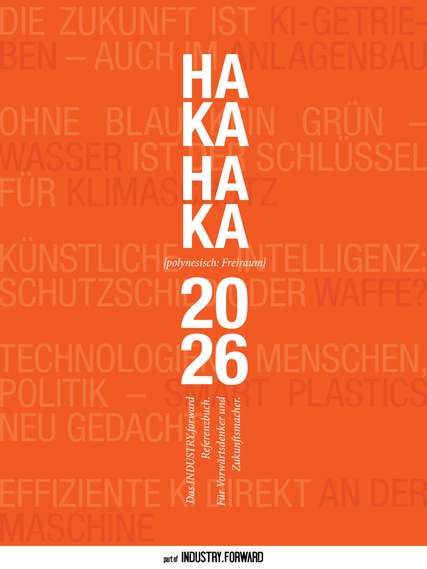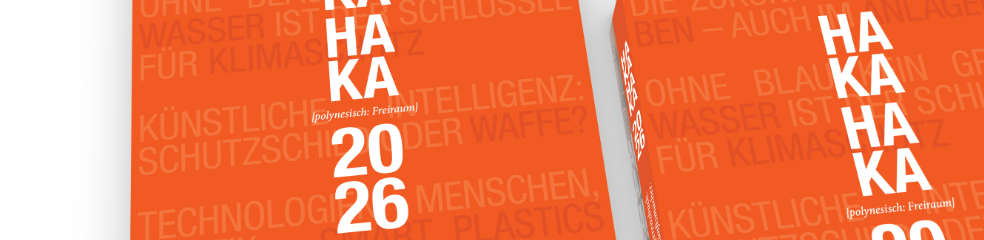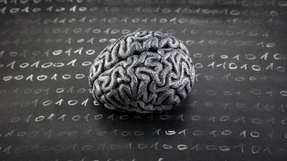Was lange Zeit nur theoretisch erschien, ist inzwischen gelebte Praxis: Generative künstliche Intelligenz verändert die Softwareentwicklung. Aktuell erleben Unternehmen aus der Industrie, wie sich nicht nur einzelne Tätigkeiten, sondern ganze Prozesse verändern. GenAI ermöglicht eine schnellere, präzisere und ressourcenschonendere Softwareentwicklung. Dadurch verschiebt sich der Fokus: Teams können sich verstärkt auf kreative, strategisch relevante Aufgaben konzentrieren, während Routinen wie Codierung, Dokumentation oder Testautomatisierung von KI übernommen werden. Diese Entwicklung klingt vielversprechend. Gleichzeitig verlangt sie jedoch nach klaren organisatorischen Weichenstellungen.
Anfang 2024 nutzten nur etwa 14 Prozent der Entwickler KI-basierte Tools zur Codierung, doch Marktanalysen gehen davon aus, dass dieser Anteil bis 2028 auf rund 90 Prozent steigen wird. Die internationale Unternehmensberatung McKinsey sieht die Softwareentwicklung zudem als eines der zentralen Anwendungsfelder unter den zukünftigen Schlüsseltechnologien.
Zentrale Treiber sind der steigende Druck auf Effizienz, kürzere Entwicklungszyklen und die Notwendigkeit zur Anbieterunabhängigkeit. Hinzu kommen Anforderungen an Datensicherheit, Compliance und die Integration in bestehende Toollandschaften. In der Praxis zeigt sich: Wer generative KI erfolgreich einsetzen will, muss den gesamten Software-Lebenszyklus in den Blick nehmen. Es genügt nicht, punktuelle Tools einzuführen. Stattdessen braucht es ein durchdachtes Zusammenspiel aus Technologie, Methodik und Qualifizierung.
Ein Beispiel aus der industriellen Praxis zeigt, wie GenAI eingesetzt wird, um Legacy-Code effizient in moderne Architekturen zu überführen. Dabei wird der vorhandene Quellcode analysiert, dokumentiert und auf Basis extrahierter Geschäftslogik automatisiert in aktuelle Programmiersprachen überführt. Dies spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Wartbarkeit und Qualität der Software
Für den Erfolg dieses Wandels ist allerdings mehr erforderlich als nur technologische Bereitschaft. Organisationen müssen Kompetenzen aufbauen, Prozesse anpassen und Verantwortung neu definieren. Dabei sind Schulungsinitiativen, neue Rollenprofile und ein strategisches Verständnis für den Umgang mit Unternehmensdaten ebenso entscheidend wie eine klare Verankerung des Themas auf Führungsebene.
Letztlich liegt der Erfolg in der Integration: Wenn generative KI nicht isoliert, sondern als durchgehender Bestandteil der Entwicklungskette betrachtet wird, zeigen sich die Potenziale besonders deutlich. Je nach Anwendungsfall lassen sich Effizienzsteigerungen von 50 bis über 80 Prozent beobachten. Besonders auffällig ist dies bei Code-Reviews, Dokumentation und Testautomatisierung. Generative KI verändert die Softwareentwicklung zwar nicht schlagartig, aber grundlegend. Und dieser Wandel ist bereits Realität – und er ist gestaltbar.