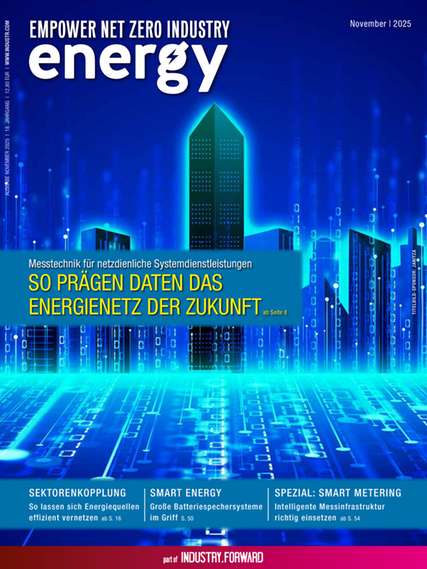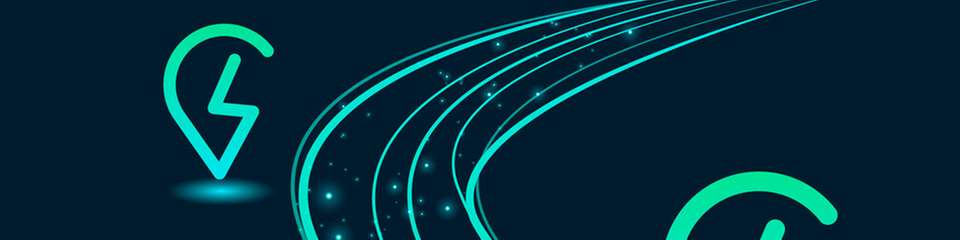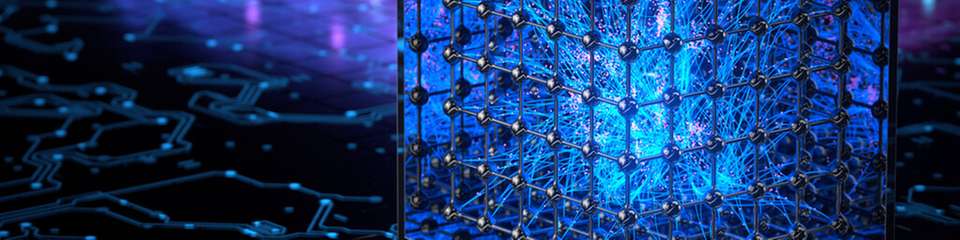Kunststoffe finden sich in allen E&E-Bereichen: In diesem Segment lag die Nachfrage der europäischen Kunststoffverarbeiter im Jahr 2021 bei über drei Millionen Tonnen. Das entspricht 6,5 Prozent der gesamten Kunststoffproduktion in Europa. Aus gutem Grund: Von Consumer-Geräten wie Smartphones und Kopfhörern bis hin zu industriellen Anwendungen wie Schalter und Steuerungen profitieren E&E-Produkte von der enormen Flexibilität, die Kunststoffe bieten. Mit Additiven wie Flammschutzmitteln, Farbstoffen oder Glasfaserverstärkungen können die Materialien unzählige Anforderungen hinsichtlich Form und Farbe, Größe und Sicherheit oder Robustheit und Standzeit erfüllen.
Mechanisches Recycling von Kunststoffen
Der große Vorteil für die Nutzungsphase wird allerdings zu einer erheblichen Herausforderung, wenn kunststoffhaltige Produkte des E&E-Sektors das Ende ihres Lebens erreichen. Denn im Gegensatz zu den enthaltenen Metallfraktionen, für die bereits seit Jahrzehnten Verfahren für das Separieren, Sortieren und Wiederverwerten etabliert sind, kommt das Recycling der Kunststofffraktionen nur langsam voran. 2021 waren erst etwas über 100.000 Tonnen Sekundärmaterialien, die für E&E-Produkte eingesetzt werden, was etwa drei Prozent der Kunststoffe entspricht.
Eine Ursache dafür ist der – verglichen mit Metallen – niedrigere Wert der Kunststoffanteile. Sie zu recyceln, ist ökonomisch weniger lukrativ. Vor allem aber stellen die vielfältigen Materialvarianten mit zahlreichen Additiven, die eine wichtige Rolle für die Performance während der Verarbeitungs- oder Nutzungsphase spielen, das Recycling vor Probleme. Wegen der schlechten Trennbarkeit werden sie bislang meist entweder zu qualitativ minderwertigen Mischkunststoffen verarbeitet oder thermisch verwertet.
Der Umgang mit Kunststofffraktionen aus der E&E-Branche entspricht weder den Ansprüchen der Verbraucher noch den wachsenden Anforderungen aus Politik und Gesetzgebung. Es geht also für alle Akteure der Wertschöpfungskette darum, die Recyclinganteile in den Bauteilen zu erhöhen, um so das Material ökologisch und ökonomisch sinnvoll zu verwerten und die Zirkularität zu erhöhen.
Studie über die Recyclingfähigkeit
Von den anwendungsgerechten Eigenschaften technischer Kunststoffe profitieren auch zahlreiche Produkte aus dem umfangreichen E&E-Portfolio von Siemens. Um die Nachhaltigkeitsziele der Kunden zu unterstützen, aber auch vor dem Hintergrund der hohen Ansprüche an die eigenen Nachhaltigkeitsleistungen verfolgt das Unternehmen vielfältige Ansätze für die Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der verschiedenen Produktbereiche. Dazu zählen Bestrebungen, die Recyclingfähigkeit von Kunststoffanteilen aus Produkten des E&E-Bereichs zu untersuchen und zu erhöhen.
Im Sommer 2023 hat Siemens deshalb eine wissenschaftliche Studie am Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik (IKK) der Leibniz Universität Hannover unter Leitung von Prof. Hans-Josef Endres initiiert und gefördert. Mit Electrocycling und Tomra waren weitere Experten für das Recycling von Stoffströmen verschiedenster Art beteiligt. Erstes Ziel des Projekts war es, das Potenzial des mechanischen Recyclings von FI-Schaltern im semi-industriellen, kleintechnischen Maßstab zu entwickeln und zu demonstrieren.
Um die Skalierbarkeit des Konzepts aufzuzeigen, wurden für die Versuche nur marktverfügbare Technologien für die Separation und Aufbereitung des Kunststoffs adaptiert. Zur Ermittlung des Potenzials für die gesamte E&E-Branche wurde zudem die Übertragbarkeit der Recyclingansätze für die untersuchten Schutzschalter auf andere Produkte des E&E-Bereichs untersucht.
Für die Studie stellte Siemens benutzte FI-Schutzschalter mit einem Gesamtgewicht von etwa 300 kg zur Verfügung. Die Produkte aus dem Sentron-Portfolio bestehen zu über der Hälfte ihres Gewichts aus thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen. Wie bei der industriellen Verwertung von Kunststoffen aus anderen Quellen durchliefen die Geräte mehrere Schritte: Bei der Zerkleinerung mit einer Schlagmühle wurden zunächst die Verbindungen zwischen den Teilen des Leistungsschalters getrennt. Anschließend erfolgte die Separierung und Sortierung von eisenhaltigen und nichteisenhaltigen Metallen durch Magnet- und Wirbelstromseparatoren. In einem weiteren Separationsschritt wurde das Kunststoffgemisch zusätzlich nach Partikelgröße in zwei Fraktionen unterteilt. Beide Kunststofffraktionen durchliefen danach den Prozess der Nahinfrarot- (NIR) und optischen Sortierung.
Für die Ermittlung der Materialeigenschaften der sortierten Fraktionen wurden aus den Fraktionen jeweils mittels eines Extruders Granulate erzeugt, die auf einer Spritzgussmaschine zu Prüfkörpern verarbeitet wurden. Diese wurden nach normierten Verfahren auf ihre Zug- und Schlagfestigkeit, resultierenden Faserlängen, Schmelzflussrate und Schmelzvolumenrate, thermische Kennwerte und Stabilität sowie die Homogenität der Farbe untersucht. Dabei wurden alle Rezyklate jeweils mit Neuware verglichen.
Die Ergebnisse der IKK-Untersuchungen waren sehr erfolgversprechend und sind eine gute Botschaft für die Recyclingfähigkeit von E&E-Produkten: Die Untersuchungen ergaben keine Verunreinigungen. Auch auf die thermischen Eigenschaften hatte das Recycling fast keine Auswirkungen. Lediglich die mechanischen Eigenschaften und die Farbqualität einiger Kunststoffe wichen von denen der Primärmaterialien ab.
Closed-Loop-Recycling von Kunststoffen
Für das künftige Handling von End-of-Life-Geräten aus dem E&E-Sektor gibt die Studie somit wichtige Impulse. Sie zeigt das große technische Potenzial des mechanischen Recyclings von Elektro- und Elektronikaltgeräten.
Siemens als Hersteller hochwertiger und langlebiger Produkte, etwa der untersuchten Schutzschalter, hat die Ergebnisse der Untersuchung bereits zum Anlass genommen, bei der Entwicklung neuer Produkte einen noch stärkeren Fokus auf das Design for Recycling zu legen. Denn die Studie zeigt, dass oft geringfügige Veränderungen der Konstruktion genügen, um höherwertige Recyclingstrategien zu entwickeln und die Kreislauffähigkeit signifikant zu verbessern.
Mit den etablierten Aufbereitungs- und Recyclinganlagen ist es unter diesen Bedingungen möglich, Kunststoffe aus Produkten des E&E-Sektors ökonomisch tragfähig zu qualitativ hochwertigen Sekundärmaterialien zu verwerten. Diese Second-Life-Materialien stellen einen Schlüssel für die Erreichung einer Kreislaufwirtschaft dar und zahlen so auf die Ziele des Degree-Rahmenwerks von Siemens ein: Der 360-Grad-Ansatz für alle Nachhaltigkeitsaspekte ist das Bekenntnis des Unternehmens zu seiner Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Klima.
Die Kreislauffähigkeit von Produkten anzugeben und sukzessive zu optimieren, ist auch Teil des Siemens EcoTech Labels: Unter Beibehaltung höchster Qualitätsansprüche bietet Siemens Kunden mit dem Label umfangreiche Informationen über die Nachhaltigkeitsleistung von Produkten. Dabei werden weitere Aspekte wie der Einsatz von sekundären oder CO2-reduzierten Materialien, die Verwendung nachhaltiger Verpackungen sowie die Energieeffizienz, Langlebigkeit und Hinweise zur Kreislaufwirtschaft berücksichtigt.
Zu den Produkten, die das Label tragen, gehören schon heute verschiedene Schutzschaltgeräte der Sentron-Reihe. Sie zeigen, dass höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen keinen Widerspruch zu bestmöglicher Recyclingfähigkeit darstellen müssen. Zudem stellen sie unter Beweis, dass sich die im Rahmen der Studie ermittelten Daten auf die industrielle Großserienproduktion skalieren lassen. Produkte, die durch hohe Qualität und recyclinggerechtes Design den Kreislauf schließen, gewährleisten so gleichermaßen die ökologische wie ökonomische Nachhaltigkeit für alle Stakeholder: von der Beschaffung über die Fertigung bis zur Recyclingwirtschaft.