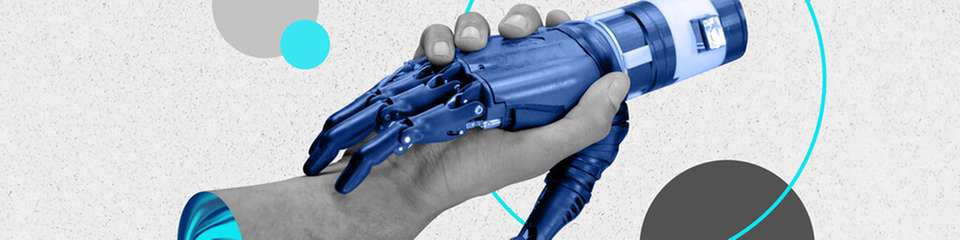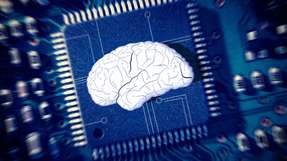Die Probleme der deutschen Autoindustrie sind hausgemacht: Jahrzehntelang lag der Fokus auf Motoren, Karosserie und Fertigung. Software war nur Beiwerk, bis Wettbewerber wie Tesla zeigten, dass der Code wichtiger ist als der Zylinder. Heute gilt: Wer die Software beherrscht, definiert das Fahrerlebnis und sichert sich neue Geschäftsmodelle.
Doch deutsche Autohersteller (OEMs) kämpfen mit überalterten Prozessen und komplexen Strukturen. Jedes Fahrzeug enthält inzwischen mehr als hundert Steuergeräte, also kleine Computer, die einzelne Funktionen wie Motor, Bremsen oder Infotainment steuern. Diese laufen oft auf unterschiedlichen Betriebssystemen. Dabei handelt es sich um grundlegende Software-Schichten, die bestimmen, wie Programme mit der Hardware kommunizieren.
Hinzu kommt, dass die Entwicklung meist in „Silos” erfolgt. Das heißt, separate Teams arbeiten isoliert an ihren Bereichen, oft mit eigenen Werkzeugen, was die Abstimmung erschwert. „Das ist wie ein Orchester, in dem jeder Musiker eine andere Partitur spielt“, sagt Dr.-Ing. Stefan Nürnberger, CEO von Veecle. Mit seinem Unternehmen wolle er der Branche eine einheitliche Plattform bereitstellen, die die Entwicklung wirklich beschleunigt und die Kosten reduziert.
Abhängigkeit von US- und China-Software
Diese strukturellen Schwächen werden durch die Abhängigkeit von ausländischen Softwareanbietern noch verschärft. Google dominiert mit Android Automotive im Infotainment, während Tesla und chinesische Player wie BYD mit geschlossenen Systemen ihre eigenen Standards setzen. „Wer hier mitmacht, verliert Gestaltungsfreiheit und gibt zentrale Kundenschnittstellen aus der Hand“, warnt Nürnberger. Die Gegenstrategie lautet daher Offenheit: eine europäische Alternative, die Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit ermöglicht. „Unser Ziel ist digitale Souveränität, eine Software-Infrastruktur, die nicht von US-Konzernen oder chinesischen Herstellern diktiert wird.“
Plattform als Gegenentwurf
Veecle setzt als Antwort darauf auf ein offenes Baukastensystem, bei dem Hardware und Betriebssysteme im Hintergrund gehalten werden. Entwickler starten nicht mit einer Simulation, die später verworfen wird, sondern mit echter Software. Dieser Code läuft von Anfang an in einer realistischen Umgebung, auch wenn die Hardware noch gar nicht existiert. Schritt für Schritt wird die Simulation durch echte Steuergeräte ersetzt, ohne dass der Code neu geschrieben werden muss. „So entsteht Serien-Software von Tag eins an, und Hersteller gewinnen wertvolle Zeit. Unser Ansatz ist nicht auf Autos beschränkt, sondern funktioniert genauso bei Drohnen, Landmaschinen oder IoT-Geräten“, erklärt Nürnberger.
Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit kontinuierlicher Aktualisierungen. Over-the-Air-Updates (OTA) machen Fahrzeuge so updatefähig wie Smartphones. Neue Funktionen und Verbesserungen können jederzeit nachgeliefert werden. Dadurch ist es möglich, Fahrzeuge auch nach der Auslieferung kontinuierlich zu optimieren. Zusätzlich eröffnet das System die Integration von KI. „KI unterstützt Entwickler schon heute dabei, komplexe Systeme überschaubar zu machen – und kann später auch von Endkunden genutzt werden, etwa um das Fahrzeug per Sprache an persönliche Bedürfnisse anzupassen“, so Nürnberger. Damit sollen europäische Hersteller in die Lage versetzt werden, mit der Geschwindigkeit von Tesla oder chinesischen Wettbewerbern Schritt zu halten, ohne Abstriche bei Sicherheit oder Qualität machen zu müssen.
Wie Vertrauen bei OEMs entstehen soll
Auf die Frage, wie Hersteller zu einem neuen Standard wechseln sollen, lautet die Antwort: Es muss Vertrauen entstehen. Nürnberger setzt dabei auf Transparenz und Offenheit. So wird das Betriebssystem als Open Source bereitgestellt und das Entwicklungsstudio ist als Software im Browser verfügbar. „Jeder Hersteller oder Zulieferer kann das System ohne lange Beschaffungsprozesse ausprobieren. Das ist ein klares Signal – wir meinen es ernst mit der Offenheit und Transparenz“, sagt er.
Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigen bereits umgesetzte Projekte mit Partnern wie Porsche, Hyundai, Magna und Infineon. „Die Zusammenarbeit mit Porsche hat gezeigt, wie weitreichend dieser Ansatz ist.“ Das Porsche-Magazin berichtete: In mehreren Porsche Cayenne und Taycan konnte die Veecle-Software neue Funktionen in Rekordzeit umsetzen – Funktionen, die es zuvor schlicht nicht gab. „Ein Beispiel: Wird ein medizinischer Notfall des Fahrers erkannt, können andere Systeme des Fahrzeugs instruiert werden, rechts ran zu fahren, den Warnblinker einzuschalten und den Sitz zurückzufahren, um einfacheren Zugriff auf die betroffene Person zu erlangen“, sagt Nürnberger. Anstelle von monatelanger Arbeit können komplexe Funktionen innerhalb weniger Tage sicher und wiederholbar auf serienreifer Hardware ausprobiert und getestet werden.
„Das Beispiel zeigt, was entsteht, wenn moderne Softwaremethoden auf Automobiltechnik treffen: schnelleres Ausprobieren, sicheres Testen und Werkzeuge, die Entwicklern die Arbeit erleichtern, ohne die Fesseln veralteter Systeme“, so Nürnberger. Entscheidend sei seiner Meinung nach die Kombination aus Geschwindigkeit und Offenheit. „OEMs wissen, dass sie mit alten Strukturen nicht gewinnen können. Wenn wir zeigen, dass unsere Plattform zum Standard werden kann, dann könnte der Wandel viel schneller kommen, als heute viele glauben.“