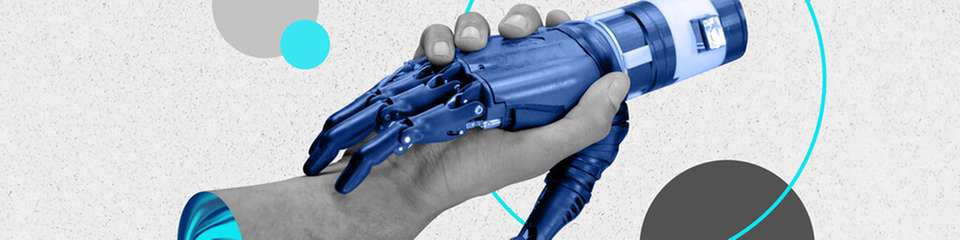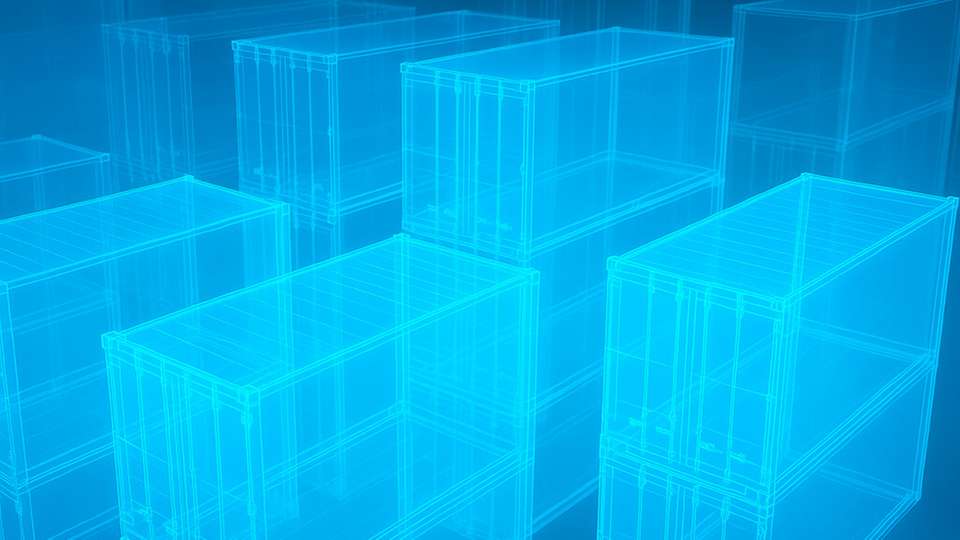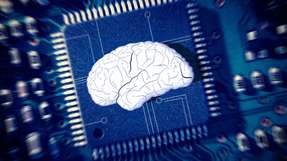Vollständige Transparenz ist auch in der Logistik so etwas wie der heilige Gral. Besteht Aussicht auf eine baldige End-to-End-Durchgängigkeit der Frachtdaten? Oder sind die Erwartungen überzogen?
Raid Kokaly
Die Erwartungen der Branche sind absolut berechtigt – aber die Realität hinkt angesichts der hohen Komplexität häufig noch hinterher. Lieferungen durchlaufen oft ein Dutzend verschiedener Unternehmen – vom lokalen Spediteur bis zum internationalen Logistikkonzern. Zudem wechseln am jeweiligen Hub – Hafen, Flughafen oder Bahnterminal – jedes Mal die Akteure: Carrier, Groundhandler und Terminalbetreiber. Und jeder hat eigene IT-Systeme, eigene Datenformate und eigene Abläufe. Hinzu kommen dann noch grenzüberschreitende Transporte mit länderspezifischen Regeln. Die Beteiligten müssen also verschiedene Portale bedienen, diverse Dokumente ausfüllen und unterschiedliche Tracking-Codes verwenden. An dieser Fragmentierung scheitert derzeit eine echte Door-to-Door-Transparenz.
Lars Schwabe
Wie es besser geht, zeigt die Luftfahrt: Selbst bei komplexen Flugrouten mit mehreren Zwischenstopps funktioniert der Datenaustausch zwischen den Airlines nahtlos. Als Passagier kann ich jederzeit meinen Flugstatus verfolgen. Diese Selbstverständlichkeit fehlt in der Logistik noch.
Liegt die Lösung in weniger Akteuren oder in einer besseren digitalen Vernetzung?
Lars Schwabe
Jeder Akteur in der Kette hat seine Daseinsberechtigung und seinen speziellen Mehrwert. Wir müssen daher lernen, mit dieser Komplexität umzugehen, statt sie zu reduzieren.
Raid Kokaly
Einige der großen Reedereien versuchen zunehmend, die gesamte Transportkette von A bis Z zu bedienen. Sie kaufen Airlines, übernehmen Lagerhallen und gehen strategische Partnerschaften mit Speditionen ein. Denn der reine Transport auf hoher See ist zur Commodity geworden – dort lässt sich also kaum noch Geld verdienen. Die Margen entstehen im intermodalen Verkehr, also darin, die Waren überhaupt erst zu den Schiffen zu bringen und sie dann von den Häfen zu den Endkunden zu transportieren. Dennoch ist eine „Verringerung der Anzahl Akteure“ nicht die Lösung. Digitalisierung gepaart mit Standards ist der Schlüssel zur Beherrschung der Komplexität.
Wo entstehen ganz konkret die größten Effizienzverluste?
Lars Schwabe
Dies betrifft vor allem das Thema Disposition und Planung. Würde man tatsächlich End-to-End planen, könnte man optimal disponieren. In der Praxis sind jedoch meist zwei oder drei Parteien beteiligt, die ihre Daten bisher nicht teilen. Die Optimierung scheitert daher vor allem an den Übergabepunkten.
Warum werden die Daten nicht geteilt – ist das ein rein technisches Problem?
Raid Kokaly
Es ist nur zum Teil ein technisches Problem. Viele Unternehmen wollen ihre Daten gar nicht freigeben. Kleinere Spediteure befürchten etwa, dass ihnen das Geschäft weggenommen werden könnte, wenn sie transparent machen, wer ihre Kunden sind und auf welchen Routen sie unterwegs sind. Deshalb meiden sie auch häufig große Plattformen.
Lars Schwabe
Hinzu kommt: Es gibt keine standardisierten IT-Schnittstellen wie in der Luftfahrt. Stattdessen existieren individuelle, bilaterale Verbindungen zwischen den Unternehmen. Bei zehn Akteuren in der Kette entstehen durch diese Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unglaublich komplexe Netzwerke – ein digitaler Flickenteppich.
Gibt es schon Lösungsansätze? Oder wie könnten diese künftig aussehen?
Raid Kokaly
In der Luftfahrt gibt es die Initiative „One Record“. Das Konzept dahinter ist, dass alle Daten zu einem Auftrag in einem einzigen Datensatz enthalten sind. Werden Daten benötigt, werden sie über eine Schnittstelle (API) direkt bei der Quelle angefragt und nicht bei jemandem, der nur eine Kopie hat. Das Prinzip lautet „Data Stays at Source”. Dieser Ansatz wäre auch für die Logistik interessant. Derzeit gibt es eine Initiative von zehn der größten Container-Reedereien der Welt (Digital Container Shipping Association, DCSA), die genau solche Standards entwickeln möchten.
Welche Rolle kann KI spielen, um die Komplexität der Logistik zu bewältigen?
Lars Schwabe
Kleinere KI-Anwendungen, die beispielsweise Vorhersagen zur Ankunftszeit eines Schiffes geben, sind schon lange Standard. Spannend sind die neuen Agentic-AI-Anwendungen. Stellen Sie sich vor: Eine Flotte gut informierter AI Agents erkennt Anomalien in der Logistikkette blitzschnell und handelt proaktiv. Sie ruft Fahrer an, ändert Dispositionen und schlägt alternative Routen vor. Wenn diese Agenten mit Infos von Sensoren und Echtzeitdaten „gefüttert“ werden, können sie sowohl mit anderen KI-Agenten als auch mit menschlichen Akteuren interagieren und alle Abläufe optimal aufeinander abstimmen.
Braucht es für solche KI-Agenten einheitliche Standards?
Lars Schwabe
Ja und nein. Standards erleichtern die Sache natürlich. Ich glaube aber, dass der Fortschritt bei der KI vieles möglich macht, wofür man früher zwingend Standards brauchte. Ein wichtiger Hebel ist das Sprachverständnis von KI und die Fähigkeit, inzwischen sehr gut mit unstrukturierten Daten umgehen zu können, beispielsweise Mails oder Frachtdokumente. Nicht umsonst gibt es im Tech-Bereich das geflügelte Wort: die neuste Trendprogrammiersprache ist Englisch. KI-Technologien haben den Zugang zu KI demokratisiert. Und gleiches passiert gerade im Datenmanagement, was auch Einfluss auf den Datenaustauschen zwischen Unternehmen haben wird.
Raid Kokaly
Die Stärke der KI besteht darin, kreativ und situativ mit den vorhandenen Daten umzugehen. Das unterscheidet sie von klassischen Algorithmus-Lösungen. Dadurch können KI-Agenten Probleme ähnlich wie Menschen lösen, indem sie beispielsweise telefonieren oder E-Mails schreiben – und das günstiger, schneller und rund um die Uhr. Die Ergebnisse sind nicht immer perfekt, aber wir erwarten auch von Menschen nicht immer Perfektion. Zudem lernen KI-Agenten sehr schnell.
Lufthansa Industry Solutions gilt unter den IT-Dienstleistern als Logistik-Experte. Was unterscheidet das Unternehmen von anderen Anbietern?
Raid Kokaly
Unsere Stärke liegt in der absolut sicheren Integration der unterschiedlichsten Systeme. Wir wissen über die Sensibilität und Bedeutung kritischer Systeme. Bei einem Kundenbesuch sagte der Geschäftsführer einer kritischen Infrastruktur jüngst zu mir: „Wenn unser System zwei Tage lang nicht läuft, ist die gesamte Transportkette in Deutschland beeinträchtigt.“ Diese Aussage verdeutlicht, mit welcher Sorgfalt wir bei unseren Projekten vorgehen müssen. Unsere Kunden fertigen täglich Hunderte Lkw, Schiffe und Flugzeuge ab. Damit dies ungestört von der Implementierung neuer IT-Systeme weiterlaufen kann, setzen wir auf bewährte und von uns erprobte Rollout-Methodiken mit Parallelbetrieb und Fallback-Szenarien. Als Teil des Lufthansa-Konzerns sind wir in einer hoch digitalisierten Branche tätig, die durch das B2C-Geschäft permanentem Innovationsdruck ausgesetzt ist. Dieses Wissen und unsere Erfahrungen übertragen wir gezielt auf andere Industrien – insbesondere auf die Logistik, in der wir über Jahrzehnte hinweg tiefgehendes Branchen-Know-how aufgebaut haben. Dank der einzigartigen Kombination aus IT-Expertise, fundiertem Branchenwissen und einer ausgeprägten Cross-Industry-Perspektive (unter anderem Airline, Logistik, Mobility, Retail, Energy) schaffen wir für unsere Kunden messbaren Mehrwert in der digitalen Transformation.
Lars Schwabe
Die fachliche Expertise für Logistikprozesse, wie wir sie von der Lufthansa kennen und am Markt umgesetzt haben, ist Gold wert. Natürlich kann jeder IT-Berater ein einzelnes System programmieren. In der Logistik mit all ihren fachlichen Domänen gehen wir jedoch einen Schritt weiter und behalten das große Ganze im Blick. Unsere jahrelangen Erfahrungen fließen in unsere Services und Innovationen ein. Dazu gehört beispielsweise eine Asset-Tracking Plattform, mit der sich einzelne Lieferungen – also einzelne Shipments – genau verfolgen lassen. Damit bieten wir unseren Kunden eine einfache und kostengünstige End-to-End-Lösung für das Tracking und die Prozessautomatisierung.