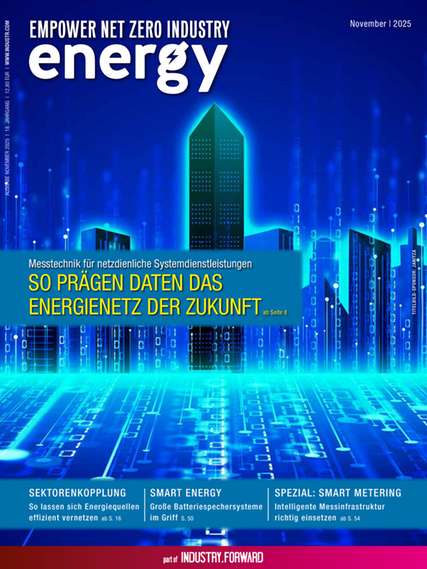Beide Szenarien – lokale Direktbelieferung und Eigenstromversorgung – sind im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vorgesehen. Sie funktionieren außerhalb des Stromnetzes und bieten energieintensiven Industriebetrieben gerade deshalb Vorteile gegenüber dem reinen Strombezug über das öffentliche Netz: als effizientere, nachhaltigere und kostengünstigere Energielösungen, die zudem mehr Unabhängigkeit von den Strommärkten ermöglichen.
Direktbelieferung mit lokal erzeugtem Windstrom
Von Direktlieferung (On-Site-PPA) spricht man, wenn ein Unternehmen von einem Windkrafterzeuger Strom über eine Direktleitung und damit außerhalb des öffentlichen Netzes bezieht. Der entscheidende Vorteil sind die deutlich geringeren Kosten für den Stromverbrauch. Denn bei einer Direktversorgung mit Strom entfallen Netzentgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen, welche für den Strombezug aus öffentlichen Netzen zu zahlen sind. Zudem sorgen Stromlieferverträge (On-Site-PPA) mit einem örtlichen Anlagenbetreiber für eine höhere Versorgungssicherheit. Und schließlich eröffnet sich mit ortsnah erzeugtem Windstrom eine neue Möglichkeit, als Unternehmen die produktionsbedingten CO2-Emissionen in Eigenregie zu verringern.
Der Bundesverband WindEnergie registriert wohl auch deshalb zum Thema Direktbelieferungen ein großes Interesse aus der Wirtschaft. Allerdings bremsen komplexe gesetzliche Vorgaben und regulatorische Hemmnisse entsprechende Projekte derzeit noch aus. Dass es prinzipiell möglich ist, solche Vorhaben zu realisieren, zeigt die 2024 gestartete Direktbelieferung von ThyssenKrupp Hohenlimburg durch die SL Naturenergie. Über ein drei Kilometer langes Kabel zum nahegelegenen Windpark bezieht der Hersteller von warmgewalztem Mittelband 40 Prozent seines Strombedarfs und senkt damit elf Prozent seiner CO2-Emissionen. Das Projekt war die erste erfolgreiche Initiative dieser Art in Deutschland.
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die physikalische Direktversorgung von Unternehmen auszuweiten. Einfachere Genehmigungsverfahren und weniger Auflagen wären für interessierte Unternehmen sicher ein wichtiges Signal.
Eigenstromerzeugung im Unternehmen
Eine Windkraftanlage auf dem eigenen Gelände oder gar ein eigener Windpark in unmittelbarer Nähe für die Selbstversorgung mit Strom? Aktuell ist das noch eine Seltenheit. Denn der Bau und Betrieb einer Windkraftanlage beziehungsweise Windparks ist im Vergleich zu einer Solaranlage aufwendiger und komplexer. Doch mit dem Wegfall der EEG-Umlage 2023 und den seither gestiegenen Stromkosten wächst auch hier das Interesse deutlich, insbesondere bei Unternehmen aus der Fertigungs- und Prozessindustrie sowie dem Anlagen- und Maschinenbau.
Die Rentabilität einer Windkraftanlage hängt von einigen Faktoren ab. Von entscheidender Bedeutung sind Anlagengröße, Standort, Investitions- und Betriebskosten. Um eine Anlage wirtschaftlich zu betreiben, schlägt insbesondere die Eigenstromnutzung positiv zu Buche. Hier gilt: je mehr, desto besser. Auch Förderungen und Einspeisevergütungen tragen dazu bei, die eigene Windkrafterzeugung profitabel zu machen. Für überschüssigen Strom, der vom Unternehmen in das öffentliche Netz eingespeist wird, steht dem Anlagenbetreiber über 20 Jahre ab Inbetriebnahme eine EEG-Förderung zu. Zudem erhält er für den gelieferten Strom eine Einspeisevergütung vom Netzbetreiber.
Bis maximal 100 kW installierte Leistung kann der Überschussstrom bei Windkraftanlagen ohne weitere Aufwände in das öffentliche Netz eingespeist werden. Bei Anlagen mit mehr als 100 kW installierter Leistung sind Betreiber verpflichtet, einen Direktvermarkter zu engagieren, der den Strom abnimmt und zum vertraglich festgelegten Preis vergütet.
Gestaltungsoptionen für die profitable Nutzung
Wenn die Windkraftanlage mehr Strom produziert, als im Betrieb verbraucht wird, gibt es prinzipiell mehrere Möglichkeiten, überschüssigen Strom profitabel zu nutzen. Interessant ist der Einsatz von Batteriespeichern. Sie dienen einerseits als Zwischenpuffer und Energielager, ermöglichen aber auch strategische Netzeinspeisungen des gespeicherten Stroms zu Zeiten hoher Energiepreise. Eine weitere Option ist die Belieferung anderer Unternehmen in der Nachbarschaft außerhalb des öffentlichen Netzes via Direktleitung, zum Beispiel im selben Gewerbegebiet.
Technische Aspekte zum effizienten Betrieb von Windkraftanlagen
Windenergieanlagen haben eine durchschnittliche Nutzungsdauer von 20 bis 25 Jahren. Damit eine Anlage möglichst optimal und ausfallfrei läuft, ist ihre technische Überwachung, Steuerung und Wartung entscheidend. Eine wichtige Grundlage dafür bildet der Einsatz professioneller Software. So kann die Leistung und der Gerätezustand im laufenden Betrieb mit spezieller Automatisierungs- und Messtechnik permanent überwacht werden, um technische Probleme früh erkennen und zu beheben, bevor es zum Ausfall kommt.
Entscheidend ist der Einsatz einer erweiterbaren Softwareplattform für die Automatisierung und Prozesssteuerung in der Stromerzeugung, -übertragung und -verteilung, wie beispielsweise die Softwareplattform Zenon von Copa-Data. Mit einer solchen technologieoffenen Lösung können über den gesamten Lebenszyklus der Anlage alle Anpassungen ohne größere Aufwände vorgenommen werden, wie zum Beispiel die Anbindung von Batteriespeichern, der Austausch von Komponenten, oder auch die Anbindung von Direktvermarktern für die kommerzielle Vermarktung überschüssigen Stroms.