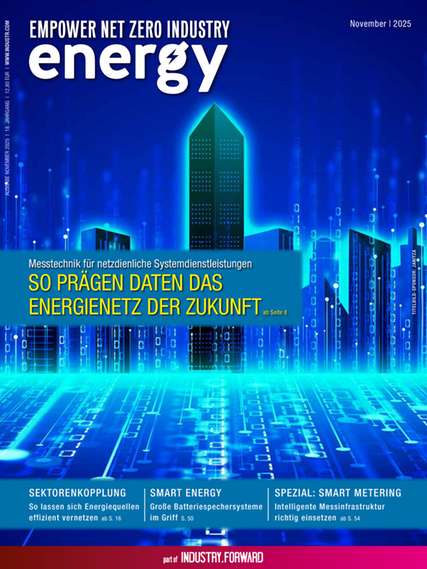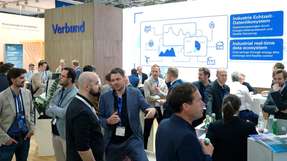Die Verteilnetze sind im Umbruch. Wärmepumpen und E-Fahrzeuge vervielfachen den Strombedarf. Gleichzeitig werden Verbraucher zu Prosumern. PV-Anlagen stellen an sonnigen Wochenenden die Netzbetreiber vor die Frage: Wohin mit dem Strom? Auf der anderen Seite droht im Winter die Dunkelflaute. Speicher im großen Stil sind noch nicht vorhanden und Reservekraftwerke so auszulegen, dass sie jede Mangellage abfangen können, stellt den Sinn von erneuerbaren Energien infrage. Dazu kommen steigende Anforderungen an die Netzqualität durch die allgegenwärtige IT, der wiederum eine wachsende Anzahl von Störquellen, etwa durch Wechsel- oder Frequenzumrichter gegenübersteht. Es gibt aber technische Möglichkeiten, die Netze für diese Herausforderungen schnell und wirtschaftlich zu ertüchtigen: neue Systemdienstleistungen.
Netzdienliche Systemkomponenten
Netzdienliche Systemkomponenten stabilisieren Stromnetze und senken Betriebskosten, indem sie Engpässe und damit den Ausbaubedarf reduzieren. Hierfür unterstützen sie einerseits bei der Betriebsführung, um beispielsweise die Netzlasten zu nivellieren. Dies erfordert zukünftig den Zugriff auf steuerbare Anlagen, um etwa Lastspitzen zu glätten oder die Netzfrequenz zu stabilisieren. Eine weitere Aufgabe ist die Blindleistungskompensation.
Die Stabilisierung der Netze ist an sich keine neue Aufgabe. Allerdings waren die Netze vor der Energiewende systembedingt robuster: Es gab weniger Störquellen, weniger anfällige Verbraucher und in den zentralen Kraftwerken sorgten riesige Generatoren, physikalisch gesehen große rotierende Massen, für stabile Verhältnisse. Das Verhalten speziell der Verteilnetze ließ sich durch Standardlastprofile hinreichend genau abbilden. All diese Werkzeuge müssen nun rasch durch neue Verfahren ersetzt werden. Eine Aufgabe, die einzelne Energieversorger kaum selbst bewältigen können. Lösungen lassen sich nur standortübergreifend und mit viel Grundlagenforschung finden.
Forschung auf Schweizer Art
Wie überall in Europa arbeitet man auch in der Schweiz an einer sicheren Energieversorgung. Das Land unterstützt die Forschung mit einem Nationalen Forschungsschwerpunkt (National Centre of Competence in Research, kurz NCCR). Über dieses Instrument vergibt das Schweizer Parlament Fördermittel aus dem Nationalfond für Grundlagenforschung. Der NCCR Automation ist ein Zusammenschluss von rund 25 Lehrstühlen aus 10 Hochschulen; geleitet wird er von der ETH Zürich. Er befasst sich unter anderem mit der Zukunft der Stromnetze. Um die Grundlagenforschung mit Daten aus der Praxis zu unterfüttern, wurde ein geeigneter Verteilnetzbetreiber gesucht. Benjamin Sawicki von der ETH Zürich NCCR Automation beschreibt das aufwändige Verfahren: „Ich bin bei dem NCCR zuständig für Wissens- und Technologietransfer, das heißt die Schnittstelle zu Gesellschaft und Industrie. Im Jahr 2021 haben wir rund 300 Verteilnetzbetreiber der Schweiz angeschrieben und viele Diskussionen geführt. Übrig blieb das Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt (WEW), das war ein Volltreffer. Es gibt Batteriespeicher, Wasserkraft und viel PV. Für uns ist das perfekt. Wir wollen zeigen, was möglich ist. Unsere Doktorandinnen und Doktoranden beschäftigen sich mit Themen, die 10 bis 20 Jahre in der Zukunft liegen. Dafür gibt es heute oft keinen Business Case. Wie sieht ein Stromnetz aus, das komplett aus Erneuerbaren Energien besteht? Das kann man sich in Walenstadt gut vorstellen.“
Ebenfalls am NCCR Automation beteiligt ist die Ostschweizer Fachhochschule (OST), vertreten durch Prof. Dr. Lukas Ortmann mit seiner Forschungsgruppe. Er bringt einen weiteren Aspekt ein: „Unser Ziel ist einerseits ein virtuelles Kraftwerk. Das heißt, man schließt alle Wallboxen, Wärmepumpen, Energiespeicher, Batteriespeicher, PV-Anlagen so zusammen, dass sie nach außen als ein großes Kraftwerk fungieren. Dieses könnte dann je nach Bedarf Blindleistung oder Wirkleistung bereitstellen. Weitere Themen sind das Auslesen der Netzebene 7 bis auf jeden einzelnen Trafostrang mit Smart-Metern oder die Regelung der PV-Einspeisung, kurz die smarte Vernetzung der Akteure im Niederspannungsnetz“, so Ortmann.
Sawicki ergänzt: „Wir können als Hochschule nichts kommerzialisieren, aber wir können einen Proof of Concept liefern. Das Potenzial virtueller Kraftwerke sollte man nicht unterschätzen. Wir können momentan im Leistungsbereich Kilowatt arbeiten. Das scheint wenig. Aber wir können zeigen, dass das Verfahren in den Megawatt-Bereich skalierbar ist und sich damit im Großen die Energiewende viel günstiger gestalten lässt als mit einem extremen Netzausbau. Viele dieser Themen werden im Projekt „Grid 2050“ untersucht.“
Die Megabatterie in Walenstadt
Drei identische Speichersysteme, bestehend aus Batterien, Wechselrichtern, Trafos und Mittelspannungsschaltanlagen, sind in Walenstadt installiert. Zusammen bilden sie das System Walenstadt, das 12 MW Leistung, beziehungsweise 15 MWh Energie für Systemdienstleistungen zur Verfügung stellt. Die Anlage ist zudem schwarzstart- und inselfähig. Die Inselfähigkeit ist aufgrund der Kapazität eher ein theoretischer Aspekt. Die Möglichkeit eines Schwarzstarts kann sich aber durchaus als wertvoll erweisen.
Sawicki erläutert das Potenzial der Anlage: „Unser Thema ist das Verteilnetz in den Netzebenen 5 und 7. Wenn wir alle Komponenten so dynamisch anfahren, dass wir Netzstabilität im Inselnetz garantieren können, könnte man diese Flexibilität und Dynamik auch dem höher gelagerten Netz anbieten. Wir könnten also das ganze Verteilnetz wie ein virtuelles Kraftwerk als einen Anschlusspunkt an das Übertragungsnetz Swissgrid verkaufen, genauer gesagt als Dienstleistung für Primär- und Sekundärregelleistung.“
Für die Finanzierung haben die Bürger von Walenstadt selbst gesorgt: Sie haben per Abstimmung einen Kredit für ihren Batteriespeicher genehmigt. Ein weiterer maßgeblicher Partner in der Projektentwicklung ist die 49Komma8 AG. Auf der Suche nach geeigneten Standorten wurde man fündig auf einer Parzelle, welche aktuell durch den Besitzer nicht genutzt wurde. Während der Projektentwicklung wurden viele Gespräche rund um das Thema BESS (Batterie-Energiespeichersysteme) geführt und daraus wurden zwei weitere BESS Projekte mit privaten Investoren gestartet. Deshalb stehen nun neben einem Batteriespeicher des WEW zwei weitere Speicher in Walenstadt. Alle drei Systeme werden netzdienlich über Swissgrid vermarket.
Die Idee, einen Batteriespeicher zu installieren, bestand schon länger, erinnert sich Felix Giger, Leiter Technik und Mitglied der Geschäftsleitung des WEW: „Ursprünglich ging es um die vielen Produktionsanlagen, die wir hier im Netz betreiben. Wir könnten durch beispielsweise Peak Shaving die Netznutzungsentgelte für unsere Kunden reduzieren. Der letzte Auslöser war dann die Energiekrise. Unter dem Eindruck damals schienen selbst so düstere Szenarien wie ein kompletter Zusammenbruch des Netzes möglich. Deshalb haben wir darauf geachtet, dass unsere Batteriespeicher schwarzstartfähig sind.“
Ein unerwarteter Datenschatz
Es versteht sich, dass nicht nur die Steuerung der Speicher lückenlose Informationen über die Vorgänge im Netz, das heißt Messdaten, erfordert. Auch die Forschungsgruppen sind auf aktuelle und historische Daten angewiesen. Und diese sind in Walenstadt vorhanden. Die Batteriespeicher sind erst 2023 und 2024 in Betrieb gegangen. Die historischen Messdaten an den Trafostationen reichen jedoch 6 bis 7 Jahre zurück. Damals wurden die ersten Janitza-Messgeräte installiert, wie sich Oliver Däster erinnert. Er ist Technischer Kundenberater Energiemanagement bei dem Schweizer Unternehmen Optec, einem Janitza Solution Partner: „WEW ist schon seit einigen Jahren unser Kunde. Die Geräte verfügen über große interne Speicher und die Messwerte lassen sich bequem über die Netzvisualisierungssoftware GridVis auslesen. Damit waren die Daten vorhanden. Da sie kaum Speicherplatz benötigen, hat man sie behalten“, bestätigt er.
Auch in den Batteriespeichern sind die UMG von Janitza zu finden. Giger beschreibt den Einsatz: „Unsere Priorität ist, dass wir den Lastfluss im Griff haben. Da wir die Geräte hinter jedem Trafo eingebaut haben, sehen wir genau, was in die Netzebene 7 fließt. Das ist auch für den PV-Ausbau wichtig. Wir sehen, wo wir noch Kapazitäten haben oder wie sich die Spannung entwickelt, wenn eine Großanlage ans Netz geht.“ Die Forschungsgruppen waren natürlich hocherfreut: „Wir können Messwerte aus den fast 30 Trafostationen exportieren und damit Modelle auf Hochschulseite nachbauen. Die Herausforderung war, diese Daten für die Forschenden zu exportieren und nutzbar zu machen. Das konnten wir mittlerweile lösen“, so Sawicki und erwähnt einen weiteren Aspekt: „Selbst die nicht mehr unterstützten alten Geräte können wir mit Modbus immer noch im Sekundentakt auslesen. Das macht für einen Netzbetreiber, der in Jahrzehnten denkt, die Geräte zu einer guten Investition.“ Stefan Fausch, Geschäftsleiter des WEW Walenstadt ergänzt: „Durch die Zusammenarbeit hat man eine Methode gefunden, um die Daten der Hochschule zur Verfügung zu stellen. Janitza und Optec haben uns dabei sehr unterstützt.“
Das Potenzial der Messgeräte geht dabei über reine Energiedaten hinaus. Johannes Luy, Area Sales Manager bei Janitza, gibt einen Überblick: „Insgesamt haben wir circa 92 Messgeräte eingesetzt, ausschließlich hochwertige Netzanalysatoren wie UMG 507, UMG 508, UMG 512-PRO und UMG 604-PRO. Dazu die Netzvisualisierungssoftware GridVis Expert. Damit ist das WEW auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet. Ladestationen, Batteriespeicher etc. beeinflussen Netze mit vielen Teilnehmern. Die Überwachung der Netzqualität ist auf unseren Geräten leicht einzurichten. Auch weitergehende Anforderungen, etwa Energiemanagement oder die Kontrolle von Normen wie der EN 50160 ist möglich. Durch die offenen Schnittstellen ist zudem eine Integration in ein Leitsystem oder andere Softwarelösungen zu realisieren.“
Fausch bestätigt: „Die Einbindung in unser Leitsystem funktioniert reibungslos. Es können sogar nicht standardisierte Systeme eingebunden werden. Auch Themen wie kapazitive und induktive Blindleistungskompensation werden kommen. Dafür werden wir vermehrt die Optionen zur Spannungsqualitätsanalyse unserer Janitza-Geräte nutzen.“
Sawicki erwähnt noch einen Vorteil für das Forschungsprojekt: „Die UMG 508 und neuer können Daten in unterschiedlichen Abtastraten erfassen. Für den Netzbetrieb reicht der Mittelwert über 15 min. Die Forschung benötigt unter Umständen Minutenwerte, und das nicht als Mittelwert, sondern gesampelt – vielleicht auch einmal Sekundenwerte. Das geht auf den neueren Modellen parallel, ohne den Betrieb zu stören.“
Damit sind in Walenstadt alle Voraussetzungen geschaffen, um einerseits das Forschungsvorhaben zu unterstützen und andererseits das Verteilnetz für die Herausforderungen der Energiewende fit zu machen.