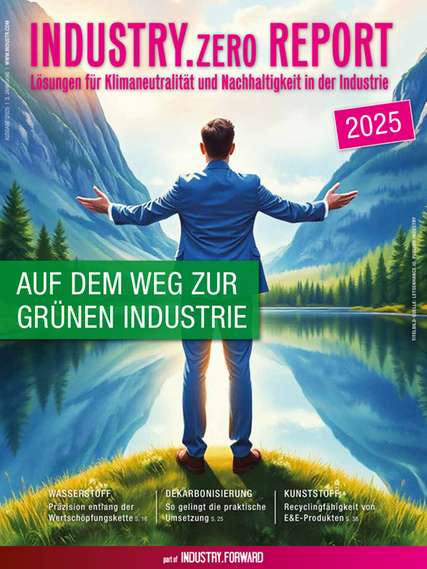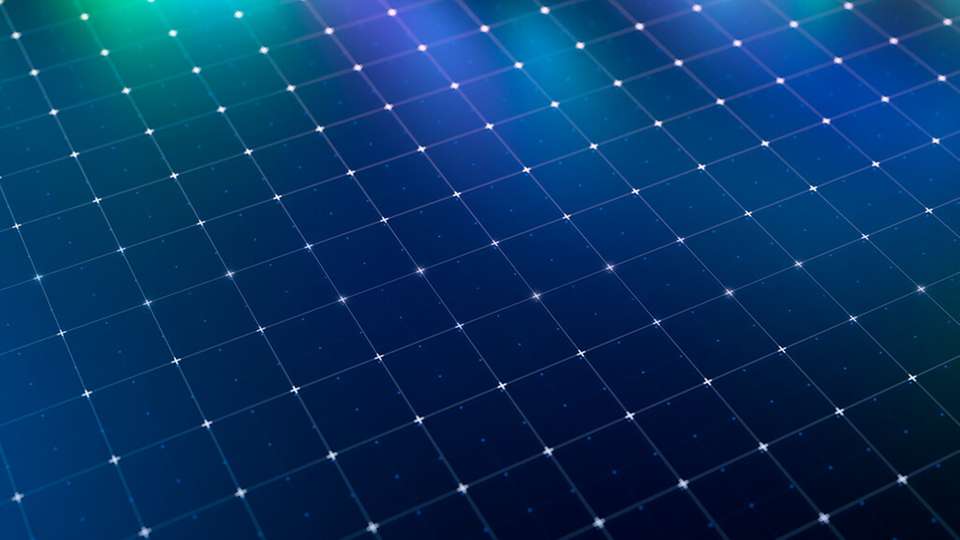Der Solarboom der Jahrtausendwende bringt für die kommenden Jahre eine große Herausforderung mit sich: Die Lebensdauer der frühen Generationen von Solarmodulen, die vor allem mit dem 100.000-Dächer-Programm ihren Durchbruch hatten, neigt sich dem Ende zu. Die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (IRENA) prognostiziert allein für Deutschland bis 2030 ein Volumen von bis zu einer Million Tonnen ausgedienter Solarmodule bei einer Einsatzdauer von unter 30 Jahren. Das optimistischere Szenario, bei dem von einem Einsatz bis 30 Jahre ausgegangen wird, prognostiziert mindestens 400.000 t End-Of-Life-Anlagen.
Langlebigkeit von Solarpanels
Die Verlängerung der Lebensdauer von Solarmodulen ist die effektivste Maßnahme für einen nachhaltigen PV-Kreislauf. Durch Aufwertungstechniken ist zukünftig sogar mit einer Lebensdauer von 40 Jahren zu rechnen. Bei Freiflächenanlagen können Produktupgrades, wie beispielsweise die Siliziumdioxidbeschichtungen, ältere Module optimieren, was die Stromproduktion steigert. Eine Langzeitstudie zeigt außerdem, dass eine Reinigung der Solarpanels bei starker Verschmutzung die Effizienz der Anlage deutlich verbessert. Und nichtsdestoweniger sind sorgfältige Installationsarbeiten und eine regelmäßige Wartung elementar für langlebige Anlagen. Deshalb sollten sowohl gewerbliche als auch private PV-Kunden auf Anbieter setzen, die seit vielen Jahren ein hohes Qualitätsniveau aufweisen. Denn die Verlängerung der Lebensdauer von PV-Anlagen ist sogar gesetzlich geregelt: Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (Paragraf 6 KrWG) setzt bei abgebauten PV-Modulen zunächst auf ihre Wiederverwendbarkeit. Falls sie noch funktionsfähig sind oder sich mit geringem Aufwand instand setzen lassen, erhalten sie ein „Second Life“. Ohne diese Prüfung ist eine Entsorgung nicht erlaubt.
Lebensdauer und Kreislaufwirtschaft
Für einen möglichst grünen Wertschöpfungsprozess in der Photovoltaik ist es dennoch wichtig, die Materialien in den Kreislauf zurückzuführen. Ist also aufgrund von Schäden oder Leistungsschwäche eine Entsorgung unvermeidbar, müssen Recyclingtechnologien zum Einsatz kommen. Auch für das Recycling von PV-Anlagen greifen wichtige gesetzliche Vorgaben wie die europäische EU WEEE-Richtlinie und in Deutschland das ElektroG-Gesetz. Doch im Verhältnis zur verbauten Modulmenge sind die aktuellen Recyclingmengen noch zu gering, um ein wirtschaftliches Recycling flächendeckend zu ermöglichen. Wie ist das zu erklären und an welchen Stellschrauben können Anlagenbetreiber und Solarunternehmen drehen, um den Modulverschleiß auf ein Minimum zu reduzieren?
Hier schlummert Verbesserungspotenzial
Mehrere Faktoren tragen zu den bisher niedrigen Rücklaufmengen von Solarpanels bei: Einerseits führt die hohe Lebenserwartung und Leistungsfähigkeit der Solarmodule dazu, dass nur langsam die kritische Menge an zu recycelnden Ressourcen vorliegt. Zudem sind PV-Module, die vor dem 24. September 2015 in Verkehr gebracht wurden, von der WEEE-Richtlinie ausgenommen, sodass sich die ordnungsgemäße Entsorgung schwer nachzuvollziehen ist.
Andererseits können umwelt- oder transportbedingte Schäden oder ein Defekt durch fehlerhafte Montage und Wartung so immens sein, dass sich ein Solarpanel nicht adäquat für das Recycling aufbereiten lässt. Außerdem braucht es mehr und einheitlichere Verbindlichkeiten in der Gesetzeslage. Denn innerhalb der EU WEEE-Richtlinie fehlt eine einheitliche Regelung, wer für das Recycling verantwortlich ist. Laut ElektroG-Gesetz sind in Deutschland die Erstinverkehrbringer zur Entsorgung von PV-Modulen verpflichtet. In der Regel betrifft das Hersteller und Importeure, die sich bei der Stiftung ear registrieren müssen, um Elektro- und Elektronikgeräte überhaupt erst in Verkehr bringen zu dürfen. Ihre Aufgabe ist es auch sicherzustellen, dass zurückgenommene Geräte ordnungsgemäß entsorgt werden. Privatpersonen und von ihnen beauftragte Installateure können bis zu 50 PV-Module kostenfrei bei öffentlich-rechtlichen Wertstoffhöfen abgeben. In anderen EU-Ländern existieren weitaus weniger strenge Gesetzesvorschriften.
Die EU kann Recycling-Standards setzen
Insbesondere durch die global-vernetzten PV-Lieferketten ist eine einheitliche Regelung für Recyclingprozesse elementar für eine möglichst nachhaltige Solar-Wertschöpfung. Folglich müssen Unternehmen ihre Recyclingprozesse besser aufeinander abstimmen. EU-Standards wie die „European Sustainability Reporting Standards“ (ESRS) bieten dabei wichtige Orientierungshilfen. Die Herausforderung besteht insbesondere darin, die stark miteinander verbundenen Module und Komponenten so zu trennen, dass eine Wiederverwertung möglich wird. Denn mit den Standardverfahren ist es aktuell noch nicht möglich, alle Materialien, wie etwa Glas, Solarzellen, Folien und Laminat, vollständig zu trennen. Verbesserte Recyclingverfahren sind daher in Zukunft notwendig. Hersteller und Installateure tragen deshalb die Verantwortung, Recycling-Komponenten frühzeitig in den Produktlebenszyklus zu integrieren.
Ins Machen kommen
Wenn zukünftig mehr Module in den Recyclingkreislauf zurückgeführt werden, könnte dies den CO2-Fußabdruck von PV-Anlagen erheblich senken. Gleichzeitig würde dies Innovationen in Recyclingtechnologien ermöglichen und Kosten der Wiederaufwertung senken. Das macht sich nicht nur in der CO2-Bilanz von Privathaushalten bemerkbar, sondern kann auch Unternehmen Wettbewerbsvorteile verschaffen. Zumal diese gesetzlich ohnehin immer stärker zu Nachhaltigkeitsberichtspflichten verpflichtet sind.
Während gesetzliche Vorschriften die Rahmenbedingungen schaffen, gehen einige Unternehmen freiwillig darüber hinaus und beginnen schon jetzt, nach Reportingvorschriften zu handeln, die in Zukunft verpflichtend werden. Dieses proaktive Handeln bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich frühzeitig auf strengere Regulierungen vorzubereiten und gleichzeitig Transparenz in ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen zu zeigen. Darüber hinaus ist es entscheidend, dass eine klare Ressourcenpolitik im Management verankert wird. Ein solcher Ansatz integriert zuverlässig Ressourcenschonung und Recyclingmaßnahmen in die langfristigen Geschäftsstrategien. Die Ressourcenpolitik eines Unternehmens bietet auch hilfreiche Entscheidungsmerkmale für Partnerschaften und ist nicht nur ein Indikator dafür, wie nachdrücklich ein Unternehmen gesetzliche Anforderungen erfüllt. Vielmehr bringt sie auch langfristig Wettbewerbsvorteile, da Verbraucher und Investoren zunehmend Wert auf nachhaltige Praktiken legen. Nicht zuletzt spielen Forschung und Entwicklung nicht nur eine zentrale Rolle bei der Optimierung des Recyclingprozesses, sondern auch für höhere Wirkungsgrade und innovative Technologien bei Speicherlösungen und weiteren Anlagenkomponenten.
Positive Tendenzen erkennbar
Zusammenfassend lässt sich durchaus behaupten, dass sich die Kreislaufwirtschaft in puncto Langlebigkeit und Wiederverwendung in eine positive Richtung entwickelt. Moderne Solarmodule erzeugen heute eine vielfach höhere Leistung als noch vor 20 Jahren, was den Einsatz wertvoller Rohstoffe deutlich reduziert. Auch die Weiterentwicklung von Recyclingtechnologien und das Produkt- und Innovationsmanagement spielen eine entscheidende Rolle, um den CO2-Fußabdruck von PV-Anlagen weiter zu senken. Schon heute kann ein Großteil der eingesetzten Materialien, insbesondere Kupfer und Aluminium, recycelt und wiederverwertet werden. Solarglas wird zwar nicht mehr zu hochreinem Glas, findet aber zum Beispiel in der Produktion von Glaswolle und Schaumglas eine neue Verwendung.
Für den weiteren Fortschritt tragen Anlagenbetreiber, Hersteller, Installateure und Entsorgungsunternehmen gleichermaßen Verantwortung. Doch insbesondere Großhändler und Systemhäuser sind gefordert, nachhaltige Komponenten zusammenzustellen und umfassendes Photovoltaik-Wissen bereitzustellen, um eine funktionierende Kreislaufwirtschaft für PV-Anlagen zu gewährleisten.