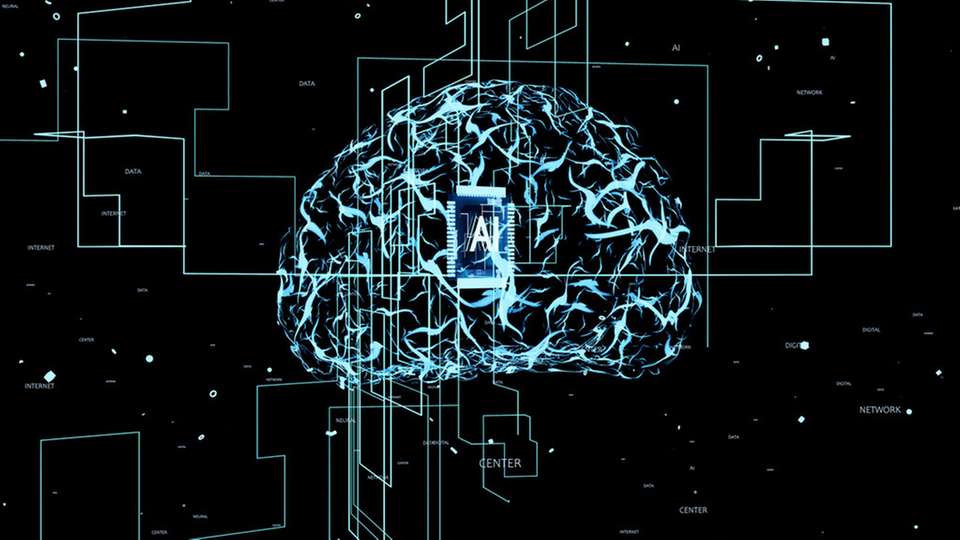Wenn ein Unternehmen seine Produktivität um 30 Prozent steigert und Produkte schneller als erwartet auf den Markt bringt, kann es gut sein, dass KI-Agenten dahinterstecken. Serviceabteilungen verkürzen die Zeit bis zur Problemlösung dank KI-Agenten, die Probleme diagnostizieren und bei der Fehlerbehebung helfen (Microsoft). Und KI-Agenten helfen, Lagerbestände zu verbessern, Lieferanten zu verwalten und die Logistik zu rationalisieren, um Kosten zu senken (McKinsey).
Generative KI-Technologien – auf denen auch KI-Agenten basieren – ermöglichen Nutzern die Interaktion in natürlicher Sprache. Doch die Agenten können nicht nur riesige Datenmengen zusammenfassen, Analysen beschleunigen und die Entscheidungsfindung verbessern, sondern auch Prozesse automatisieren.
Was sind die technologischen Voraussetzungen für den Einsatz von KI-Agenten?
KI-Agenten stützen sich auf die in Unternehmenssoftware gespeicherten und verwalteten Daten. Damit ist ein effektives Datenmanagement unerlässlich. Zudem sind drei Komponenten erforderlich:
Vektordatenbanken: Neben Daten speichern sie auch unstrukturierte Inhalte, zum Beispiel Prüfreports, Anforderungsdokumente, Freitextfelder oder Videos. So lassen sich auch aus Quellen Erkenntnisse gewinnen, die bisher kaum analysiert werden konnten.
Semantische Schicht: Sie verbindet KI-Agenten und Unternehmensdaten. Hierfür erkennt sie in natürlichen Fragen wie „Welche offenen Änderungsanfragen betreffen das Bauteil X?“ die relevanten Schlüsselbegriffe – hier „Änderungsanfrage“ und „Bauteil X“ – ordnet sie den richtigen Datenobjekten im System zu und generiert eine Abfrage. Wenn mehrere Unternehmenssysteme eine semantische Schicht zugeordnet haben, können KI-Agenten nahtlos die Daten all dieser Systeme analysieren.
APIs: Die Programmierschnittstellen ermöglichen es KI-Agenten, nicht nur Daten abzurufen und semantische Suchen in Vektordatenbanken durchzuführen, sondern auch aktiv spezialisierte Tools aufzurufen und Workflows auszulösen.
Welche Funktionen können KI-Agenten ausführen?
Je nach Art der KI-Agenten können sie unterschiedliche Funktionen übernehmen. Man unterscheidet folgende Arten:
Basis-Agenten: Sie beraten und unterstützen, indem sie Nutzern Informationen bereitstellen und Fragen auf der Grundlage von Kontextdaten beantworten. Sie dienen vor allem der Effizienzsteigerung, indem sie den Zeitaufwand für die Suche nach Daten reduzieren und Arbeitsabläufe vereinfachen.
Advanced Agents: Diese fortgeschrittenen Agenten können bestimmte Aufgaben erweitern oder automatisieren. Stellt beispielsweise ein Servicetechniker eine Frage zur Terminplanung, kann der KI-Agent basierend auf dem Kontext des Technikers automatisch neue Kalenderereignisse erstellen. Hierfür nutzen diese Agenten Large Language Models (LLMs), mit denen sie natürliche Sprache verarbeiten, die Absicht des Nutzers ableiten und den Fortschritt von Aufgaben überwachen können.
Zudem sind sie in der Lage, generative Funktionen zu nutzen, um eine Antwort zu erstellen oder Code-Snippets zu generieren, die Aktionen in anderen Tools oder Agenten auslösen. Diese Advanced Agents versprechen vor allem eine Prozessoptimierung. Denn sie helfen, Fehler zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Außerdem ermöglichen sie Kostensenkungen durch geringeren manuellen Aufwand und eine höhere betriebliche Effizienz.
Multi-Agenten-Architektur: In einer solchen Architektur arbeiten mehrere spezialisierte Agenten unter einem Koordinationsagenten zusammen. Letzterer weist den Spezial-Agenten Aktionen zu und überwacht diese. Ein Beispiel ist die Service-Management-Lösung ServiceMax. Hier beantwortet ein spezialisierter Service-Historie-Agent Fragen auf Basis von Arbeitsauftragsdaten, ein Terminplanungs-Agent plant mithilfe des Kalenders des Technikers, des Arbeitsauftrags und des Kundenkontexts Termine.
Welche praktischen Einsatzszenarien gibt es für KI-Agenten in der Industrie?
KI-Agenten lassen sich in zahlreichen Use Cases einsetzen. Vier praktische Anwendungsfälle verdeutlichen das Potenzial:
1. Digitale Rückverfolgbarkeit: Entsprechend spezialisierte Agenten überwachen Änderungen an Anforderungen, Entwürfen und Systemmodellen, benachrichtigen die entsprechenden Ingenieure darüber und empfehlen passende Aktualisierungen. Ist eine Änderung erforderlich, verknüpft der KI-Agent automatisch neue oder aktualisierte Objekte auf Grundlage der Datenontologie.
Vorteile: Ingenieure sparen viel Zeit bei der routinemäßigen Datenverknüpfung und Überwachung von Änderungen, sodass sie sich auf die Qualitätssicherung konzentrieren können. Innerhalb der Entwicklungsabteilung wird eine bessere Zusammenarbeit möglich.
2. Unternehmensweites Änderungsmanagement: Änderungen in einem System können sich auch auf andere auswirken. Das macht das Management technischer Änderungen zur komplexen Angelegenheit. Change-Management-Agenten analysieren Abhängigkeiten in den Bereichen Software, Mechanik und Elektrik. Sie prognostizieren die Auswirkungen von Änderungen, bevor diese implementiert werden. Ingenieure können diese überprüfen bevor sie Entscheidungen treffen.
Vorteile: Weniger Probleme in nachgelagerten Prozessen und beschleunigte Genehmigungen.
3. Product Line Engineering: KI-Agenten erstellen auf Basis natürlicher Sprache erste Systemmodelle und unterstützen Ingenieure bei der Standardisierung von Komponenten und Konfigurationen über verschiedene Produktlinien hinweg. Bei Änderungen passen sie Konfigurationen dynamisch innerhalb des Variantenraums an.
Vorteile: Der Zeitaufwand für die Erstellung von Systemmodellen verringert sich, verschiedene beteiligte Teams können sich besser abstimmen.
4. Virtuelle Produktvalidierung: KI-Agenten automatisieren die Erstellung von Testszenarien und Validierungsabläufen und beschleunigen so nachgelagerte Ergebnisse, die für Software- und Hardwarekomponenten erforderlich sind, um die Anforderungen an Konformität, Sicherheit und Leistung zu erfüllen, bevor physische Prototypen erstellt werden.
Vorteile: Sie steigern die Qualität der Produktvalidierung und minimieren den Zeitaufwand für dokumentenlastige Aufgaben.
In all diesen Fällen gilt: Die KI-Agenten sind nicht als Ersatz für Ingenieure zu verstehen. Sie entlastet diese aber von Recherche- und Routineaufgaben und verschafft ihnen so erheblich mehr Freiraum, um sich auf Neues zu konzentrieren.
Was ist bei der Einführung von KI-Agenten zu beachten?
1. Zugang zu sauberen, aktuellen Daten schaffen: Jede KI ist nur so gut wie die Daten, auf denen sie basiert – das gilt auch für KI-Agenten. Die Daten müssen nicht nur aktuell und korrekt sein, sondern auch zugänglich. Manche Aufgaben erfordern gar den Zugang zu Daten aus verschiedenen Unternehmenssystemen. In der Realität findet sich jedoch oft ein Flickenteppich aus veralteten Dokumenten auf Festplatten bis hin zu aktuellen Daten in Systemen, die jedoch nicht immer integriert sind. In der IBM-Studie räumt denn auch die Hälfte der befragten CEOs ein, dass ihr Unternehmen über eine uneinheitliche, unkoordinierte technologische Infrastruktur verfügt. So ist es nicht verwunderlich, dass diese CEOs auch berichten. Dass nur ein Viertel der KI-Initiativen in den letzten Jahren den erwarteten ROI gebracht hat, lediglich 16 Prozent haben eine unternehmensweite Skalierung erreicht.
Der erste Schritt sollte deshalb darin bestehen, die Daten in Ordnung zu bringen. Viele haben damit bereits begonnen, etwa durch den Wechsel von dokumentenzentriertem zu teilezentriertem PLM oder die Verlagerung von Anforderungen von Excel in rückverfolgbare Systeme wie Codebeamer.
2. Kulturellen Wandel nicht unterschätzen: Die Einführung von KI erfordert neue Fähigkeiten, veränderte Prozesse und organisatorische Anpassungen. Diese Veränderungen stellen viele Mitarbeitenden vor (scheinbar) große Herausforderungen und können Ängste und Unsicherheit auslösen. Ein durchdachtes Change Management ist deshalb unabdingbar. Dazu gehört, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass KI ein Beschleuniger sein kann, der Mitarbeitenden hilft, intelligenter und schneller zu arbeiten. Um sicherzustellen, dass KI verantwortungsvoll und effektiv eingesetzt wird, gilt es Schulungen durchzuführen und bewährte Verfahren zu etablieren,
3. Regulatorische Vorgaben berücksichtigen: KI-Systeme müssen transparent und erklärbar sein und mit Standards wie der DSGVO, ISO-Normen oder der EU-KI-Verordnung übereinstimmen. Doch KI entwickelt sich schneller als Vorschriften. Deshalb müssen sich Unternehmen fortlaufend mit komplexen Compliance-Anforderungen auseinandersetzen.
Fazit
Unternehmen, die die Potenziale verschiedener Formen der KI verstehen und diese Aspekte berücksichtigen, haben die besten Voraussetzungen, um sich an die Spitze des Wettbewerbs zu setzen. Sie können nicht nur, wie im Anfangsbeispiel genannt, ihre Produktivität steigern und ihre Time-to-Market verkürzen, sondern auch die wachsende Komplexität durch zunehmende Variantenvielfalt und Regularien sowie global verteilte werke in den Griff bekommen, geopolitischen Spannungen und volatilen Lieferketten mit Agilität begegnen, nachhaltiger wirtschaften und trotz Fachkräftemangel und Kostendruck Innovationen vorantreiben.