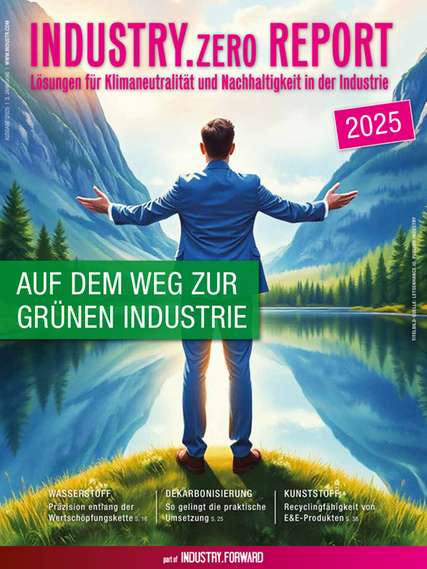Batteriespeicher sind keine Zukunftstechnologie mehr, sondern weltweit in einer Vielzahl von Anwendungen Realität geworden und nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Mit ihren system- und netzdienlichen Eigenschaften sind sie zu einem zentralen Baustein der Energiewende geworden, in der Wind- und Sonnenenergie eine immer größere Rolle spielen. Ob als Puffer für volatile Einspeisung, als Ersatz für Reservekraftwerke oder zur Netzentlastung: Speicher sind vielseitig einsetzbar und ohne jegliche Förderung wirtschaftlich tragfähig.
Auf dem Weg zu einer flächendeckenden Versorgung mit Speichern in Deutschland gibt es noch mehrere Hürden zu überwinden. Auch wenn jede einzelne bewältigbar erscheint, können sie zusammengenommen den Speicherhochlauf deutlich ausbremsen. Was sich für die Speicherbranche wie die Bürde der sieben biblischen Plagen anmuten könnte, sollte im Sinne einer konstruktiven Herangehensweise als sieben Brücken verstanden werden, über die man im Dialog zwischen Politik, Netzen und Speicherbranche gehen beziehungsweise sich aufeinander zubewegen muss. „Die Herausforderungen der Speicherbranche sollten nicht als Bürde, sondern als sieben Brücken verstanden werden, über die Politik, Netzbetreiber und Branche gemeinsam in den Dialog treten können“, Georg Gallmetzer, Geschäftsführer der Eco Stor. Dazu sind klare politische Weichenstellungen, strategische Entbürokratisierung und ein mutiger Blick auf die Energiemärkte von morgen gefragt. Ist das Gewicht der Belastungen zu hoch, brechen die Brücken und damit die Chance auf eine kostengünstige Transformation der Energieversorgung ein. Damit das nicht passiert, bedarf es einer offenen Debatte mit Blick auf alle sieben Herausforderungen.
1. Baukostenzuschüsse fair gestalten
Batteriespeicher werden beim Netzanschluss wie industrielle Verbraucher behandelt und müssen entsprechend hohe Baukostenzuschüsse zahlen. Hierfür hat der Bundesgerichtshof den Netzbetreibern im Juli 2025 in einem Grundsatzurteil einen weiten Ermessensspielraum eingeräumt. Die Folge sind erhebliche Zusatzkosten gegenüber klassischen Erzeugungsanlagen. Der BGH hat allerdings einen ersten Brückenpfeiler angelegt: wenn durch den Betrieb des Speichers Netzausbau nicht verursacht wird, kann der Netzbetreiber von der Erhebung von Baukostenzuschüssen absehen. Nun sind Bundesregierung und Bundesnetzagentur am Ruder, Klarheit zur Ausgestaltung nicht netzausbauverursachender Voraussetzungen zu schaffen, anhand derer Batteriespeicher rechtssicher von der Erhebung von Baukostenzuschüssen ausgenommen oder in erheblichem Ausmaß rabattiert werden. Hier ist beispielhaft das Stichwort der Einführung flexibler Netzanschlussverträge zu nennen, die nicht netzbelastendes Verhalten vorschreiben und eine praxistaugliche Grundlage für die Differenzierung bei der BKZ-Erhebung bilden können.
2. Netzentgelte Systemdienlich reformieren
Stromspeicher sind gemäß §118 (6) EnWG bis August 2029 von Netzentgelten befreit. Danach droht jedoch eine vollständige Entgeltpflicht, was Batteriespeicher in systemdienlicher Betriebsweise vor nicht finanzierbare Zusatzkosten stellen würde. Dass Netznutzer einen angemessenen Beitrag zur Finanzierung der Netzinfrastruktur zahlen sollen, ist unbestritten – man kann das mit der Autobahnmaut vergleichen. Wenn Batteriespeicher durch ihr Verhalten jedoch die Netzinfrastruktur entlasten, müsste das gerechterweise entlastend auf die Erhebung der Entgelte wirken, also wie ein Mautrabatt auf der Straße. Darüber hinaus können Netzbetreiber mit gezielten Netzentgelt-Preissignalen das Verhalten von Speichern präzise und zuverlässig im Sinne der Netzdienlichkeit lenken.
Mit dem Zielmodell dynamischer Netzentgelte würde eine Win-Win-Win-Situation geschaffen, wie es eine von Eco Stor beauftragte und von Neon durchgeführte Studie belegt: Speicher verhalten sich mit dynamischen Netzentgelten deutlich netzdienlicher als ohne, Netzbetreiber sparen deutlich an Netzkosten, und die Netzentgelte sinken schlussendlich für die Letztverbraucher. Die technische Umsetzbarkeit wäre über Verfahren der kurzfristigen Engpassprognosen sichergestellt, wie sie viele der großen Netzbetreiber bereits ausüben oder deren Einführung planen. Es obliegt nun der Bundesnetzagentur, sich über die Brücke der komplexeren dynamischen Netzentgelte zu wagen. Die Studie hat dazu einen ersten Brückenpfeiler gesetzt.
3. Tempolimit auf Batteriespeicher
Netznutzer sollen zur Wahrung der Netzstabilität nicht beliebig schnell in beliebigem Umfang ihre Leistung am Netz ändern,sonst können es Netzbetreiber im Falle eines Netzengpasses diesen nicht rechtzeitig erkennen und gegensteuern. Aus Sorge vor solchen Systeminstabilitäten bürden Netzbetreiber Batteriespeichern deshalb bei der Leistungsänderung ein hartes Tempolimit weit jenseits der gängigen Normen auf. Gleichzeitig können Batteriespeicher technisch wesentlich schneller regeln als sämtliche thermische Kraftwerke und Erneuerbare – ein Vorteil, der derzeit oft ungenutzt bleibt. Am Beispiel des Blackouts in Spanien im April 2025 hätte eben dieser Vorteil mit einer Flotte von Speicherkraftwerken dämpfend auf die Netzinstabilität gewirkt und den Blackout eventuell sogar verhindert, aber mindestens dessen Ausbreitung eingedämmt.
Nicht zuletzt bedeutet ein Tempolimit – auch Rampenrestriktion genannt – einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil für die Betreiber. Vor allem kurzfristige Störungen im Stromsystem beinhalten ein starkes Preissignal, das durch das Limit in den Leistungsrampen nicht mehr genutzt werden kann. Ein Tempolimit für Batteriespeicher muss also in Abwägung zwischen den Nachteilen der Blackout-Prävention und Anlagenwirtschaftlichkeit sowie der sicheren und zuverlässigen Netzengpass-Vorbeugung getroffen werden. Mit moderner Digitalisierung der Netzführung, verbesserten Prognoseverfahren und höher automatisierten Netzüberwachungssystemen lassen sich diese Maßnahmen heute sicher und kontrolliert umsetzen. Dies wird aufgrund der benötigten Infrastrukturänderungen nicht mittelfristig fertig sein, sollte aber zeitnah begonnen werden.
Das Ziel muss es sein, Tempolimits nur dann zu verhängen, wenn sie aus Gründen der Verkehrssicherheit nötig sind, sonst aber nicht. Eine etablierte Praxis deutscher Verkehrspolitik. Eco Stor und auch diverse Netzbetreiber (zum Beispiel einige EON-Töchter, Allgäunetz, LVN) haben daher begonnen, an ihren Anlagen unter dem Schlagwort „digitaler Zwilling“ für die Engpassprognose Brückenpfeiler für die Überwindung des Digitalisierungsrückstands in der Netzinfrastruktur zu setzen, um passgenaue Lösungen auch im Hinblick dynamischer Rampen-Einschränkungen zu entwickeln.
4. Einspeisrestriktionen feinjustieren
Netzkapazität ist ein knappes Gut und vielerorts bereits ausgeschöpft. In bestimmten Netzsituationen gelten dann pauschale Einspeisebeschränkungen. Was deutlich nützlicher und weniger schädlich für alle Beteiligten ist, sind feinjustierte Einspeisevorgaben, die netzschädliches Verhalten verhindern und alle anderen Zeiten von Betriebsbeschränkungen präzise ausklammern. Der Gesetzgeber hat mit der Einführung flexibler Netzanschlussverträge dazu die Grundlagen gelegt. Nun muss die Branche in einem Dialog zwischen Netzbetreibern und Speicherbetreibern konkrete Regelungen ausgestalten.
Dabei ist eine präzise und deshalb dynamische Vorgabe der Leistungsbeschränkung unerlässlich, um starre und unnötige Restriktionen zu verhindern. Nicht zuletzt hierfür sind digitale Zwillinge in der Netzengpass-Prognose ein wichtiges Tool, wie auch bei Rampen. Am Standort Bollingstedt – dem derzeit größten Batteriespeicher Deutschlands – ist ein dynamisches Netzmodell im Einsatz, das von Eco Stor entwickelt wurde. Dieses könnte Vorbild für flexible Netzanschlussverträge der Zukunft sein.
5. Regelleistungsbegrenzungen mit Maß
Die Teilnahme an Regelleistungsmärkten ist für Batteriespeicher zumindest noch in diesem Jahrzehnt ein wichtiger Erlöspfad. Allerdings ist es für Verteilnetzbetreiber schwer nachvollziehbar, knappe Netzkapazität für die Stabilisierung des europäischen Verbundnetzes aus Anlagen an ihrem Netz zu reservieren. Deshalb werden von Netzbetreibern zunehmend Teilnahmeverbote oder restriktive Obergrenzen für die Teilnahme von Speicherbetreibern an Regelleistungsmärkten verhängt. Eine Kappung der Regelleistungs-Teilnahme sollte das letzte verbleibende Mittel sein, ist es aber häufig nicht.
Auch Verteilnetzbetreiber profitieren von stabiler Netzfrequenz. Insbesondere durch den Wegfall von Massenträgheit im Stromsystem aufgrund des Kohle- und Atomausstiegs müssen neue Wege für Stabilität gewählt werden. Die Einführung des Markts für Momentanreserve wird die Lücke decken. Doch auch hierfür braucht es Anlagen, die an dem Markt teilnehmen, auch im Verteilnetz. Eine Brücke könnten hier zeitvariable, Engpass-abhängige Regeln zur Regelleistungs-Teilnahme sein. Sie sind ein milderes und genauso zweckmäßiges Mittel, das einer pauschalen Restriktion vorzuziehen ist – ein weiterer Schritt nach vorne auf einer der Brücken, die es zu überschreiten gilt.
6. Batteriespeicher in Redispatch einbinden
Die Batteriespeicher werden häufig nicht im Redispatch eingebunden, da es erhebliche Unsicherheit bezüglich des Speicherfahrplans und dessen Vergütung gibt. Um einen Batteriespeicher in der Redispatch-Planung berücksichtigen zu können, muss der Netzbetreiber mit einem erheblichen Vorlauf Bescheid wissen, wie sich der Speicher verhalten wird. Eine Vorfestlegung der Fahrplanposition bedeutet für den Speicher allerdings, dass er für kurzfristige Marktsignale nicht mehr zur Verfügung steht. Dies ist einerseits problematisch für den Strommarkt, weil dem Markt kurzfristige Flexibilität entzogen wird. Es wirkt sich auch negativ auf für die Speichergeschäftsmodelle aus, da ein Teil der Markterlöse am kurzen Ende vor Erbringung vorenthalten bleibt.
Um eine Speicherflotte in dem für Deutschland prognostizierten Zubaubedarf in Höhe von 50 GW zu realisieren, ist jedoch eine Einbindung in den Redispatch und insbesondere eine Vorfestlegung von Fahrplänen unumgänglich. Wir müssen also unbedingt eine regulatorische Brücke finden, um einerseits den Netzbetreibern mehr Planungssicherheit zum Speicherverhalten zu schaffen, als auch die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Batteriespeicher abzumildern. Eine Vereinbarung zur trichterartigen Fahrplan-Festlegung über die Zeit vor Erbringung könnte ein Lösungsansatz sein.
7. Flexibilitätsmärkte vor Kannibalisierung
So wie Krankenhäuser Notstromaggregate vorhalten, sind Netzbetreiber dazu verpflichtet, Versorgungsengpässe abzusichern. Im Zweifel könnte dies mit zusätzlichen Kapazitäten geschehen und darf Geld kosten. Ein subventionierter Kraftwerkszubau bewirkt allerdings eine klare Marktverzerrung zulasten sauberer Technologien und langfristiger Flexibilitätsoptionen.
Zielführender kann eine Marktöffnung für alle Technologien mit einheitlichen Kriterien (zum Beispiel Reaktionszeit, CO2- Intensität, Verfügbarkeit) und ihre technologische Gleichbehandlung sein. Deutschland ist mit dem Problem der Leistungsabsicherung in Zeiten der Dunkelflauten nicht allein. Allerdings hat man in anderen Ländern Wege gewählt, eine nicht marktverzerrende und trotzdem sichere Regelung zu Kapazitätsmechanismen zu finden. Diese Brücke muss nicht neu erfunden, sondern aus anderen Ländern (wie zum Beispiel Belgien) nachgebaut werden.
Brücken bauen statt Barrieren bewahren
Das Überschreiten dieser sieben Brücken ist keine Utopie – sie ist machbar. Jede einzelne steht für eine konkrete Stellschraube im regulatorischen Gefüge mit verschiedensten Interessensgruppen, die heute noch den Fluss marktwirtschaftlicher, technologischer und klimapolitischer Potenziale hemmt. Mit dialogorientierter Ausgestaltung und klarem Systemverständnis könnten wir zum Taktgeber für ein flexibles, resilientes und emissionsfreies Energiesystem werden – mit Batteriespeichern als tragendem Pfeiler. Wir müssen es nur wollen.