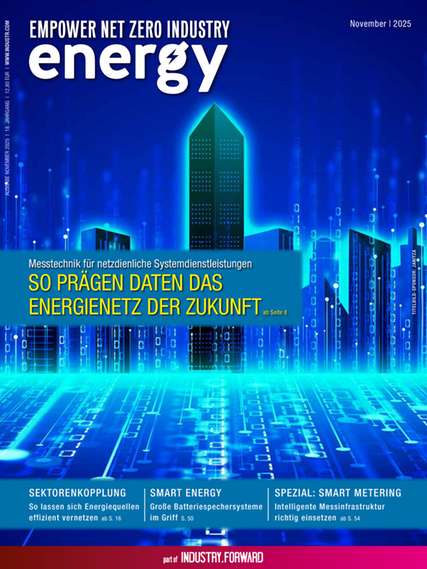Der Eigenverbrauch selbst erzeugten Stroms wird für Betreiber von Photovoltaikanlagen zunehmend attraktiver – nicht zuletzt aufgrund sinkender Einspeisevergütungen und steigender Strompreise. Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb ist jedoch die Möglichkeit, überschüssige Energie sicher zu speichern. Der Markt für Batteriespeichersysteme entwickelt sich dynamisch und bietet inzwischen eine Vielzahl modularer, vorkonfigurierter Lösungen. TÜV Süd erläutert die Anforderungen bezüglich Sicherheit, Technik und Genehmigung für den Einsatz im industriellen und gewerblichen Umfeld.
Stationäre Batteriespeicher werden als vorkonfigurierte, anschlussbereite Systeme verkauft. Mit der Inbetriebnahme und Integration werden sie jedoch zu einem festen Bestandteil der elektrischen Anlage und unterliegen damit den geltenden Vorgaben zur Prüfung und Überwachung ortsfester elektrischer Betriebsmittel.
Der Prüfbedarf ergibt sich nicht allein aus der Kapazität stationärer Batteriespeicher, sondern aus den daraus resultierenden Risiken: hohe Spannungen, Stromstärken, Energiemengen oder mögliche Brandlasten. Gehören die Speicher zur elektrischen Energieversorgung im Unternehmen, verlangt auch die Gesetzliche Unfallversicherung eine regelmäßige Überprüfung (DGUV Vorschrift 3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel)– insbesondere im Hinblick auf den Schutz gegen elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brandgefahr. Die DIN VDE 0105-100/A1 (Betrieb/Prüfung von elektrischen Anlagen) konkretisiert diese Prüfanforderungen und stellt sicher, dass Betrieb, Wartung und Prüfung elektrischer Anlagen systematisch erfolgen.
Die Art der Nutzung, Umgebungsbedingungen und potenzielle Gefährdungen fließen in die Festlegung von Art, Umfang und Intervallen der Prüfungen ein. Auch thermische Risiken, Alterungsprozesse von Komponenten sowie der Zustand von Sicherheitseinrichtungen spielen eine wichtige Rolle. Ergänzend können Prüfungen zur Funktion der Kommunikationseinrichtungen, zur Zustandsbewertung des Batteriemanagementsystems (BMS) oder zur Integrität der Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100-410 nötig sein.
Integration ist entscheidend
Auch wenn PV-Anlage und Speicher jeweils normgerecht installiert und geprüft sind, entstehen Risiken an den Schnittstellen zur bestehenden Gebäudeinfrastruktur. Mit zunehmender Systemvernetzung steigt die Komplexität – eine klare Definition von Zuständigkeiten und Schnittstellen zwischen Gewerken ist daher unerlässlich.
Insbesondere bei sicherheitsrelevanten Funktionen wie Netzersatzbetrieb, Notstromversorgung oder Abschaltung müssen Verfügbarkeitsanforderungen, Lastprofile und Betriebsmodi exakt aufeinander abgestimmt sein. Während ein Speicher für Ladeinfrastruktur nur eine eingeschränkte Versorgungssicherheit erfordert, gelten für sicherheitskritische Systeme deutlich strengere Anforderungen. Diese Unterschiede müssen bereits bei der Planung und Integration berücksichtigt werden.
Installation und Betrieb
Der Aufstellort für stationäre Batteriespeicher unterliegt abhängig von Größe und Nutzung rechtlichen und technischen Anforderungen. Die aktualisierte Muster-EltBauVO enthält hierzu konkrete Vorgaben – etwa zu Brandlasten, Lüftung, Abschottung und der Einbindung in die Gebäudesicherheitstechnik. In bestimmten Fällen kann eine brandschutztechnische Bewertung oder die Anbindung des Speichers an eine Brandmeldeanlage gefordert sein. Die Einbindung in das Brandschutzkonzept wird empfohlen. Große Batteriespeicher sind oft in eigenen Containern untergebracht. Diese stellen die Feuerwehr im Brandfall vor besondere Herausforderungen. Deshalb finden bei einigen Herstellern spezielle Löschtrainings für die Einsatzkräfte statt.
Die Kapazität ist ebenfalls entscheidend für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb. Hier sollte über die gesamte Lebensdauer regelmäßig überprüft werden, ob ein Speicher seine Nennleistung (noch) erbringen kann. Experten raten, die Leistungsfähigkeit auf jeden Fall vor Ablauf der Gewährleistung (in der Regel zwei Jahre, viele Hersteller gewähren freiwillig fünf oder mehr Jahre) zu überprüfen. Die freiwillige Prüfung lässt sich sehr gut mit den ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen verbinden.
Empfehlungen
Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) hat 2021 einen Leitfaden herausgegeben, in dem er explizit eine strukturierte Betriebssicherheitsstrategie empfiehlt. Bestandteile dieser Strategie sind eine erste Prüfung bei Inbetriebnahme, ein Brandschutz-Check im Rahmen der Sicherheitsprüfung sowie ab einer Kapazität von über 50 kWh die Abstimmung mit der Feuerwehr. Sorgfältige Dokumentation aller Systemparameter und der Integration trägt ebenso zur Betriebssicherheit bei wie geschultes Personal und der Nachweis über diese Schulungen.
Gängige Speichertechnologien und ihre Risiken
Gewerbliche und industrielle Anwendungen nutzen verschiedene Systeme, um Solarstrom zu speichern. Die gängigste Technologie, die in 95 Prozent der Neubauten eingesetzt wird, sind Lithium-Ionen-Systeme mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen (zum Beispiel Lithium-Titanat, Nickel-Mangan-Kobalt oder Lithiumeisenphosphat). Als Folge von Überhitzung (thermisches Durchgehen) können diese Systeme zum Teil in Brand geraten oder explodieren. Rückzündungen nach ersten Löschversuchen stellen eine zusätzliche Gefahr dar.
Gleichzeitig können toxische Gase entstehen oder das Wasser durch Elektrolyte kontaminiert werden. Diese Gefahren machen Brände im Zusammenhang mit Lithium-Ionen-Speicher besonders komplex und gefährlich. Deshalb kann bei Verwendung dieser Technologie eine Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV vorgeschrieben sein, die sowohl die Prüf-Intervalle als auch die -Inhalte festlegt.
Für höhere Zyklenzahlen und Kapazitäten ab 100 kWh werden häufig Redox-Flow-Systeme eingesetzt. Diese speichern die Energie im Unterschied zur klassischen Batterie in flüssigen Elektrolyten in einem externen Tank. Die Elektrolyte können korrodieren und müssen gemäß der BetrSichV und der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) als Gefahrstoffe gelagert werden.
Anwendungen mit geringerer Energiedichte oder Pilotprojekte verwenden vielfach Natrium-Ionen-Batterien. Deren Gefahrenpotenzial ist geringer als das anderer Technologien, es fehlt allerdings noch an Langzeiterfahrungen. Im Spitzenlastmanagement finden sich auch hybride Lösungen, zum Beispiel als Kombination aus Batterie und Schwungrad oder Kondensatoren.
Batteriespezifische Normen
Die Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU ) schafft den rechtlichen Rahmen für Batteriespeicher an PV-Anlagen. Konkretisiert wjrd sie durch spezifische Sicherheitsnormen für die jeweilige Batterietechnologie. Relevant sind hier vor allem die IEC 62619 (Sicherheitsanforderungen für Lithium-Batterien in industriellen Anwendungen), die IEC 63056 (Sicherheitsanforderungen für die Verwendung von Lithium-Sekundärzellen in elektrischen Energiespeichersystemen), die IEC 62485 (Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen) oder die IEC 62933-2-1(Einheitsparameter und Prüfverfahren für elektrische Energiespeichersysteme).