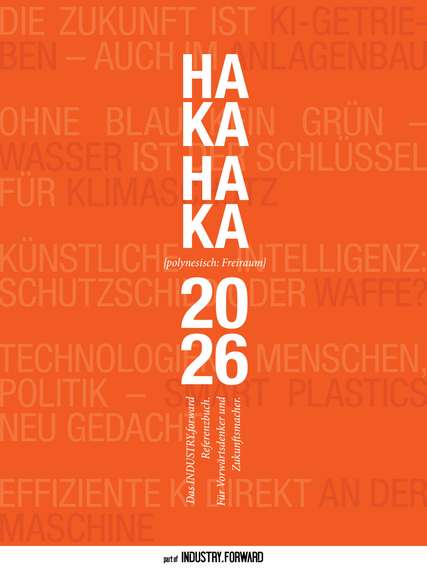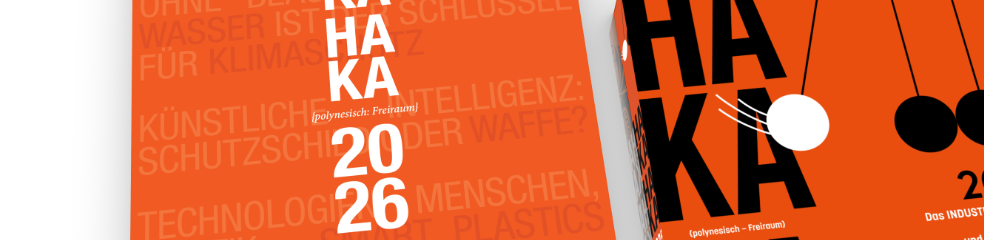Vernetzte Produktionsumgebungen gelten heute als Rückgrat moderner Industrie. Sensoren, cloudbasierte Steuerungssysteme, autonome Anlagen – sie steigern Effizienz, ermöglichen vorausschauende Wartung und eröffnen neue Geschäftsmodelle. Doch mit dieser technologischen Vernetzung wächst auch die Komplexität der Sicherheitslage. Angriffsszenarien, die vor wenigen Jahren noch als theoretisch galten, lassen sich heute automatisiert skalieren. Besonders Künstliche Intelligenz verändert die Spielregeln – nicht nur zum Schutz, sondern zunehmend auch als Waffe.
Die Bedrohung beginnt oft unsichtbar: personalisierte Phishing-E-Mails, generiert durch Large Language Models, die auf öffentlich verfügbare Daten zugreifen und inhaltlich kaum noch von menschlicher Kommunikation zu unterscheiden sind. Dabei geht es nicht mehr um das klassische Szenario des nigerianischen Prinzen, sondern um maßgeschneiderte Inhalte, adressiert an konkrete Personen – basierend auf LinkedIn-Posts, Konferenzteilnahmen oder firmeneigenen Publikationen. Die technischen Möglichkeiten dafür sind vorhanden. Noch entscheidender aber ist die Geschwindigkeit, mit der sie sich verbreiten.
Parallel dazu entwickeln sich sogenannte Deepfakes. Inzwischen ist es möglich, Videokonferenzen mit täuschend echten, manipulierten Gesprächspartnern zu simulieren. Die Kombination aus geklonten Stimmen, synthetisch generierten Gesichtsausdrücken und Echtzeitmanipulation stellt selbst erfahrene Mitarbeitende vor Herausforderungen. Was als triviale Sicherheitslücke begann, wird zum Risiko auf Vorstandsebene – wenn etwa Zahlungen freigegeben werden, weil eine visuell überzeugende Anweisung „von oben“ kommt.
Diese Bedrohungen lassen sich technisch nicht vollständig eliminieren. Tools zur Deepfake-Erkennung existieren, aber sie laufen dem Fortschritt meist hinterher. Der Schlüssel liegt daher in der Verbindung aus technischer Absicherung und robusten Prozessen: klare Verifikationsschritte, etablierte Vier-Augen-Prinzipien und gezielte Schulung aller Beteiligten. Cybersicherheit muss heute nicht nur Systeme schützen, sondern Entscheidungswege stabilisieren.
Gleichzeitig darf Sicherheit nicht zur Innovationsbremse werden. Künstliche Intelligenz ist kein Risiko per se – sie ist ein Werkzeug. Richtig eingesetzt, kann sie Angriffe frühzeitig erkennen, Systeme entlasten und Analysezeiten massiv verkürzen. Voraussetzung dafür ist eine Architektur, die nicht ad hoc zusammengefügt wird, sondern von Anfang an Sicherheit mitdenkt: Verschlüsselung, Zugriffskontrollen, Auditfähigkeit – als Grundbestandteil, nicht als späteres Add-on.
Die industrielle Landschaft wird sich weiter vernetzen, weiter digitalisieren – und dabei weiter angreifbar bleiben. Wer Cybersicherheit als kontinuierlichen Gestaltungsauftrag versteht, sichert nicht nur seine Anlagen, sondern auch Vertrauen in eine zunehmend algorithmische Welt. In einer Produktion, die autonom denkt, muss Sicherheit nicht nachrüsten – sondern vorausdenken.