Seit dem 2. Februar 2025 gilt der EU AI Act als europaweit einheitlicher Rechtsrahmen für den Einsatz Künstlicher Intelligenz. Ziel der Regelung ist es, den Schutz von Grundrechten, Gesundheit und Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig Fortschritt zu fördern. Ein zentraler Bestandteil der Verordnung ist Artikel 4. Dieser fordert Anbieter und Betreiber von KI-Systemen auf, sicherzustellen, dass alle beteiligten Personen über ausreichende KI-Kompetenz verfügen und macht auch vor Unternehmen der Energiebranche nicht Halt. Auch sie sind verpflichtet, diese zügig umzusetzen, um Verstöße zu vermeiden, die nicht nur hohe Bußgelder, sondern auch erhebliche Reputationsschäden nach sich ziehen können. Der nachfolgende Beitrag erläutert die Anforderungen des EU AI Acts im Hinblick auf KI-Kompetenz und zeigt auf, wie Unternehmen diese erfolgreich umsetzen können.
Zunächst stellt sich natürlich die Frage, was KI-Kompetenz konkret bedeutet. Der Gesetzgeber versteht darunter die Fähigkeit, Künstliche Intelligenz sachkundig, verantwortungsvoll und sicher einzusetzen. Dazu gehört technisches Wissen über die Funktionsweise und die Grenzen von KI-Systemen, ein Bewusstsein für die Chancen und Risiken von KI im rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Kontext sowie Kenntnisse darüber, welche Schäden KI verursachen kann und wie sich diese vermeiden lassen.
Wer ist betroffen?
Die Pflicht zur Sicherstellung der KI-Kompetenz gilt für Unternehmen jeder Größe und unabhängig von der Art des eingesetzten KI-Systems. Selbst Anwendungen mit allgemeinem Verwendungszweck wie Chatbots fallen darunter. Der EU AI Act betrifft Anbieter von KI-Systemen ebenso wie Unternehmen, die solche Systeme betreiben, sowie externe Auftragnehmer, die im Auftrag einer Organisation KI nutzen oder betreiben. Damit sind nicht nur Entwickler oder IT-Fachkräfte gemeint, sondern auch Anwender in Fachabteilungen sowie externe Partner, die in betriebliche KI-Prozesse eingebunden sind.
Was die Umsetzung betrifft, so schreibt der EU AI Act keine standardisierten Schulungsformate oder verpflichtende Zertifizierungen vor. Unternehmen haben die Freiheit, den Kompetenzaufbau selbst zu gestalten und individuell an ihre Bedürfnisse anzupassen. Dennoch müssen sie jederzeit plausibel darlegen können, dass ihre Maßnahmen geeignet und wirksam sind. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Dokumentation: Inhalte, Dauer, Teilnehmer und Zeitpunkte der Maßnahmen sollten festgehalten werden. Nur so kann im Falle einer Prüfung oder eines Schadensfalls nachgewiesen werden, dass die gesetzlichen Anforderungen erfüllt wurden.
Vier Schritte zur Umsetzung in der Praxis
Der Aufbau von KI-Kompetenz ist ein kontinuierlicher Prozess und sollte strukturiert erfolgen. Folgende vier Schritte helfen bei der Orientierung:
Bedarf ermitteln: Zunächst gilt es für die Unternehmen zu analysieren, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt mit KI-Systemen arbeiten, welche Systeme im Einsatz sind, zu welchem Zweck diese genutzt werden und welche Risiken bestehen.
Maßnahmen gestalten und umsetzen: Die Trainings- und Schulungsangebote sollten auf die Rollen, Vorkenntnisse und Verantwortlichkeiten der Beteiligten zugeschnitten werden. So benötigen Entwickler oft tiefergehendes technisches Wissen (zum Beispiel KI-Anwendungen verstehen und anwenden), während andere Mitarbeitergruppen eher ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise von KI und regulatorischen Fragestellungen aufbauen müssen (zum Beispiel zum Thema Ethik und der EU AI Act)
Wissen aktuell halten: Da sich Technologien und rechtliche Rahmenbedingungen laufend ändern, gilt es für Unternehmen, ihr erlangtes KI-Wissen regelmäßig aufzufrischen. Hier eignen sich interne Wissensplattformen, Fachvorträge, Erfahrungsaustausch sowie externe Weiterbildungen.
Dokumentation sicherstellen: Alle Maßnahmen sollten systematisch dokumentiert werden, um im Bedarfsfall einen Nachweis erbringen zu können.
Wo finden Unternehmen Hilfe bei der Umsetzung?
Zahlreiche Initiativen bieten Unternehmen bereits erste Hilfestellungen – etwa mit Webinaren, FAQs oder Praxisbeispielen sowie Beratungs- und Workshop-Formaten zum EU AI Act. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) kann das ein guter Einstieg sein. Zusätzlich gibt es verbindliche Dokumente auf den offiziellen Websites der EU. Als zentrale Anlaufstelle für den AI Act in Deutschland bietet auch die Bundesnetzagentur einen AI Service Desk an. Allerdings kann die Vielzahl der Anlaufstellen und Dokumente auch verwirrend sein. Dazu kommt, dass die Hilfestellungen immer sehr allgemein gehalten sind, damit sie auf verschiedene Bereiche und alle betroffenen Unternehmen passen.
Das bedeutet: Sobald es um die konkrete Umsetzung der Anforderungen im eigenen Betrieb geht, reichen diese allgemeinen Ressourcen nicht mehr aus. Hier ist individuelle Beratung und Begleitung erforderlich, die exakt auf den aktuellen Wissensstand und die spezifischen Anforderungen zugeschnitten ist. Genau hier setzen auf KI spezialisierte Anbieter wie handz.on an. Als spezialisierte IT-Dienstleister für KI bieten sie ein modular aufgebautes Schulungs- und Trainingsangebot, das sich nahtlos an die Bedürfnisse sowie den individuellen KI-Wissensstand jedes Unternehmens anpassen lässt. Es ist praxisnah, direkt umsetzbar und bietet einen spürbaren Mehrwert im Alltag.
Konkret liefern diese Dienstleister wertvolle Hilfestellungen, um etwa den Bedarf zu analysieren, verschiedene Nutzergruppen und Rollenprofile zu identifizieren sowie um passende Schulungen durchzuführen, deren Kernelemente sich bereits in anderen Unternehmen bewährt haben. Auch liegt der Dokumentationsaufwand dann in der Hand des IT-Dienstleisters, sodass sich das Unternehmen darum nicht mehr kümmern muss und bei potenziellen Kontrollen den nötigen Nachweis erbringen kann, sich in puncto KI-Kompetenz weitergebildet zu haben.
Mit weiterführender Kompetenz können IT-Dienstleister Unternehmen zusätzlich dabei helfen, die verwendeten KI-Systeme in die Risikoklassen des EU AI Acts einzuordnen und im Falle eines Hochrisiko-KI-Systems entsprechende Handlungsempfehlungen und Umsetzungsstrategien bezüglich des Risiko-Management-Systems, der Registrierungspflichten oder der Daten-Governance aufzeigen.
Fazit: Rechtspflicht und Chance zugleich
Der EU AI Act stellt nicht nur eine regulatorische Herausforderung dar, sondern bietet auch die Chance, den verantwortungsvollen Umgang mit KI fest in der Unternehmenspraxis zu verankern. Wer den Kompetenzaufbau systematisch angeht, reduziert nicht nur rechtliche Risiken, sondern verschafft sich auch einen strategischen Vorteil. Denn Mitarbeitende, die die Chancen und Risiken der Technologie verstehen, können KI gezielt und innovativ einsetzen, ohne dabei die notwendigen Sicherheits- und Compliance-Aspekte aus den Augen zu verlieren. Außerdem zeigt die Erfahrung, dass Mitarbeitende, die KI besser verstehen, sicherer im Umgang mit diesen Systemen sind, weniger Angst davor haben, durch KI ersetzt zu werden, und sie stattdessen als sinnvolle, entlastende Ergänzung wahrnehmen.






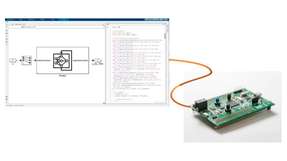
.jpg)







