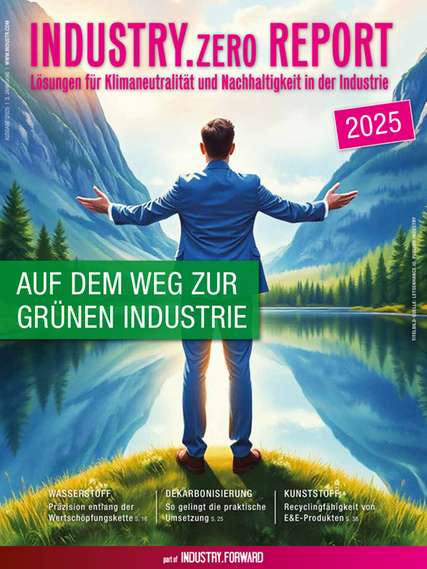Mit dem Übergang vom klassischen Einspeisemanagement zu Redispatch 2.0 hat sich die Verantwortung im Stromnetz spürbar verschoben – von den Netzbetreibern hin zu den Betreibern technischer Ressourcen. Was als digitalisierter Eingriff zur Netzstabilisierung gedacht war, stellt Betreiber vor erhebliche Herausforderungen. Fehler im Abstimmungsprozess und die Komplexität führen immer wieder zu Abweichungen und Verzögerungen. Mit finanziellen Auswirkungen. „Betreiber sollten daher genau hinschauen und Unstimmigkeiten nachgehen!“, so Alexander Lange, Leitung Redispatch bei wpd-Windmanager.
Der Redispatch-Prozess ist aufwendig. Die Berechnung und Abstimmung der Ausfallarbeit erfordert Fachwissen. Anforderungen an Datenmanagement, Kommunikation und Abrechnung sind hoch. Gleichzeitig fehlen vielen Betreibern die Kapazitäten, um die Prozesse effizient umzusetzen. „Doch der Aufwand lohnt sich. Jede verlorene Kilowattstunde ist bares Geld“, so Lange. „Wer den Prozess nicht selbst umsetzen kann, sollte Experten beauftragen.“ Sein Team betreut aktuell über 250 Windparks und bearbeitete allein im letzten Jahr rund 10.000 Redispatch-Schaltungen. Tendenz steigend.
Mit Redispatch 2.0 wird der Direktvermarkter als Einsatzverantwortlicher (EIV) eingebunden. Statt Ertragsausfälle zwischen Anlagen- und Netzbetreiber abzustimmen, erfolgt die Koordination nun zwischen Netzbetreiber und Betreiber der technischen Ressource (BTR). Betreiber können diese Rolle selbst übernehmen oder an Direktvermarkter beziehungsweise Dienstleister übertragen. „Die Erfahrung zeigt, dass externe Dienstleister meist die besten Ergebnisse erzielen“, sagt Lange, auch Obmann der Arbeitsgemeinschaft Redispatch. „Oft rentiert sich das schon bei wenigen Schaltungen pro Monat.“
Worauf sollten Betreiber bei der Wahl des Dienstleisters achten?
Wichtig ist, dass der Dienstleister die BTR-Rolle gemäß Vorgaben der BNetzA erfüllt, proaktiv agiert und Ertragsausfälle vor Versand der Erstaufschläge prognostiziert. Das Clearing erfolgt in der Regel innerhalb von drei Tagen. Fehlmengen müssen nachgehalten oder Gegenvorschläge unterbreitet werden. Vorteil gegenüber Direktvermarktern: „Wir bieten auch das spitze Abrechnungsverfahren an. Besonders bei wenigen Schaltungen ist dies deutlich lukrativer“, erklärt Lange.
Was kommt künftig auf Betreiber zu?
Laut interner Konsultation der BNetzA wird ab 2027 das spitze Abrechnungsverfahren generell verpflichtend. Das spitze Verfahren erfordert eine konstante Bereitstellung von Echtzeit-Wetterdaten. „Spätestens dann ist eine Umstellung erforderlich“, so Lange. „Zwischen 2027 und 2031 erfolgt zudem die Umstellung aller Windparks vom Prognose- ins Planwertmodell. Dann steigen die Anforderungen noch weiter an.“ Gut, wenn man Experten an seiner Seite hat, die alles im Blick haben und im Griff behalten.