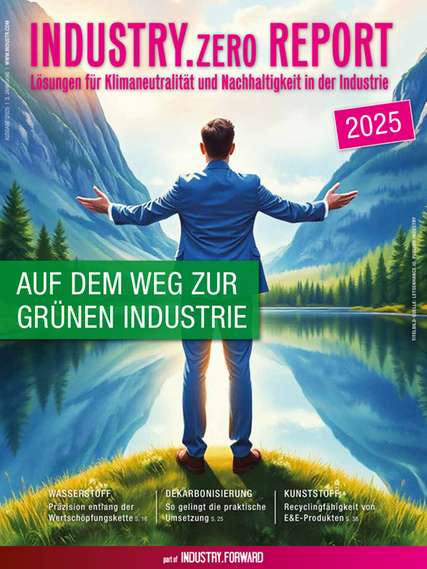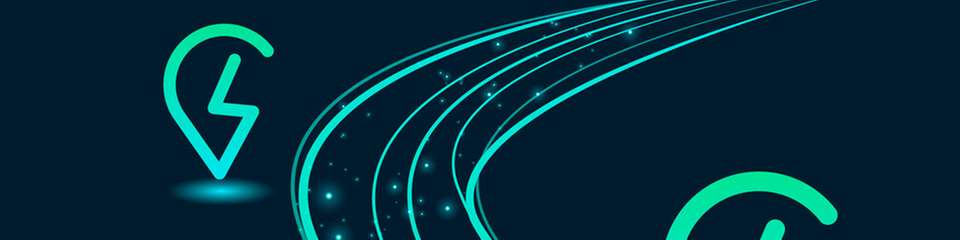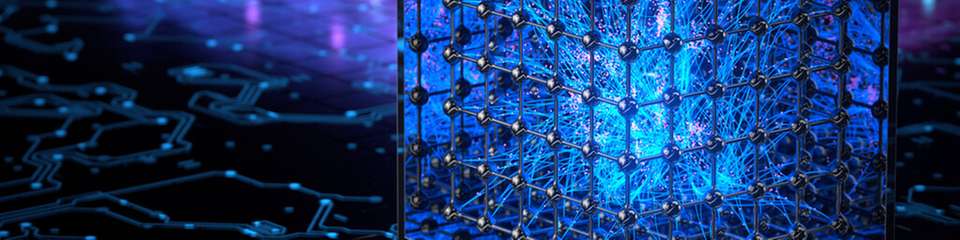Fortschritt im Energiesektor sind entscheidend für den Übergang zu einer nachhaltigen, sicheren und erschwinglichen Energieversorgung, die für die Bewältigung des Klimawandels unerlässlich ist. Für die in der renommierten Fachzeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews veröffentlichte Studie analysierten die Forschenden über 2.600 wissenschaftliche Publikationen und verdichteten 142 davon zu einer systematischen Übersicht über unternehmerisches Handeln im Energiesektor.
Drei Gründungstypen im Fokus
Die Studie identifiziert drei wesentliche Formen von Unternehmertum: technologieorientierte, gemeinschaftsbasierte und ländlich geprägte Gründungen. Dabei spielen Technologie-Start-ups eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und Umsetzung neuer Energielösungen wie Batterierecycling oder KI-gestützter Netzsteuerung. Gemeinschaftsinitiativen wiederum fördern die lokale Energiewende, während ländlich geprägte Start-ups den Zugang zu bezahlbarer Energie insbesondere in strukturschwachen Regionen verbessern.
„Start-ups erschließen neue Innovationsfelder und treiben das Wirtschaftswachstum voran, indem sie traditionelle Paradigmen hinterfragen und moderne Technologien gezielt einsetzen“, sagt Dr. Florian Degen, Mitautor der Studie und Bereichsleiter für Strategie- und Unternehmensentwicklung an der Fraunhofer FFB. „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung erneuerbarer Energien und spielen eine Schlüsselrolle auf dem Weg in eine nachhaltigere Energiezukunft.“
Markteintrittsbarrieren hemmen Fortschritt
Gerade im dynamischen Umfeld der Energiewende könnten Start-ups wichtige Impulse liefern. Beispielsweise durch intelligentere Solarsysteme, neue Batterietechnologien oder die Organisation lokaler Energiegenossenschaften. Doch der Marktzugang ist oft durch komplexe Strukturen und hohe Eintrittsbarrieren erschwert. „Im Vergleich zu anderen Branchen ist die Einführung und Skalierung neuer Technologien im Energiesektor mit erheblichen technischen und betrieblichen Herausforderungen verbunden“, erklärt Linda Brüss, Co-Autorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Entrepreneurship der Universität Münster. „Besonders die Integration in bestehende Infrastrukturen oder deren Ersatz stellt junge Unternehmen vor große Aufgaben.“
Hinzu kommt eine komplexe und sich häufig ändernde Regulierungslandschaft. „Die Energiewirtschaft ist stark reguliert und der rechtliche Rahmen unterscheidet sich teils erheblich je nach Region oder Land“, sagt Professor David Bendig, Mitautor und Direktor des Instituts für Entrepreneurship an der Universität Münster.
Politische Unterstützung als Erfolgsfaktoren
Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Start-ups im Bereich der erneuerbaren Energien entscheidend zur Energiewende beitragen können, sofern die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen. Unternehmerische Innovationskraft allein reicht jedoch nicht aus. Gefragt sind eine gezielte politische Unterstützung, stabile rechtliche Rahmenbedingungen und der Zugang zu geeigneten Ressourcen.
Um Chancen und Risiken frühzeitig zu erkennen, sollten Start-ups den Autoren zufolge regulatorische Entwicklungen aktiv verfolgen und sich in politische Prozesse einbringen. Auch strategische Partnerschaften, etwa mit etablierten Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder anderen Start-ups, sowie die Anpassung von Geschäftsmodellen an lokale Gegebenheiten sind wichtige Hebel.
„Unsere Analyse zeigt, dass Start-ups nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial eine transformative Rolle spielen können“, betont Florian Degen. „Damit dieses Potenzial realisiert wird, braucht es missionsorientierte Förderprogramme, verlässliche Zukunftssignale und eine Beschleunigung zentraler Entscheidungsprozesse.“