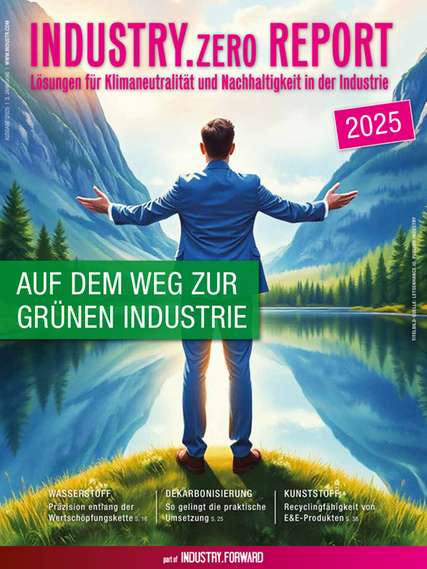Energieautarkie, Kontrolle der Stromkosten und eine nachhaltige Energieversorgung sind längst keine Zukunftsvisionen mehr. Anhaltend hohe Strompreise, steigende Abgaben und Unsicherheiten auf den Energiemärkten haben den Druck auf die Industrie in den vergangenen Jahren massiv erhöht. Viele Betriebe suchen deshalb nach Möglichkeiten, unabhängiger vom Strommarkt zu werden und ihre Energiekosten langfristig zu senken.
Aktuelle Zahlen verdeutlichen die Dringlichkeit: Laut der „Strompreisanalyse 2025” des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lag der durchschnittliche Strompreis bei Neuabschlüssen für kleine bis mittlere Industriebetriebe im Mai 2025 bei 18,31 Cent pro KWh inklusive Stromsteuer. Das entspricht einem Anstieg um 1,22 Cent pro KWh gegenüber dem Vorjahr. Nicht zuletzt deshalb wird in der Politik seit Jahren intensiv über staatlich subventionierte Industriestrompreise diskutiert, die besonders energieintensive Unternehmen entlasten sollen. Vorgesehen ist derzeit ein Preisdeckel von etwa fünf Cent pro Kilowattstunde, von dem rund 2.000 Unternehmen profitieren könnten. Allerdings ist eine Genehmigung auf europäischer Ebene derzeit keineswegs gesichert. Für viele Betriebe bleibt damit die Kostenbelastung hoch und die Unsicherheit bezüglich künftiger Energiepreise bestehen.
Gleichzeitig entstehen Chancen für den wirtschaftlichen Einstieg in die Eigenversorgung. Die Preise für Photovoltaik-Module, Wechselrichter und andere Schlüsselkomponenten sind inzwischen deutlich gesunken. Auch die Betriebskosten lassen sich durch neue Technologien und Planungsprozesse zunehmend verbessern. Daher trägt der Aufbau eigener Erzeugungsanlagen für Unternehmen heute nicht nur zur Versorgungssicherheit bei, sondern ist auch wirtschaftlich attraktiv.
Eigenstromversorgung als strategische Antwort
Der Weg zur Eigenstromversorgung über Photovoltaikanlagen, Blockheizkraftwerke oder moderne Speicherlösungen hat zahlreiche Vorteile. Unternehmen, die ihren Strombedarf teilweise selbst decken, profitieren von geringeren Energiekosten, sie reduzieren ihre Abhängigkeit von Preisschwankungen und tragen zudem aktiv zum Klimaschutz bei. Die Eigenstromproduktion verbessert darüber hinaus das Unternehmensimage und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.
Damit dies technisch, wirtschaftlich und regulatorisch funktioniert, ist die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern sinnvoll. Energieversorgungsunternehmen mit entsprechender Expertise unterstützen dabei, überschüssig produzierten Strom gewinnbringend zu vermarkten, etwa über die Direktvermarktung an der Börse. Sie übernehmen zudem das Management virtueller Bilanzkreise, also die intelligente Abstimmung zwischen Eigenproduktion, Verbrauch und Netzeinspeisung in Echtzeit. Und nicht zuletzt sorgen sie für die zuverlässige Belieferung mit ergänzendem Strom, sodass der Betrieb jederzeit abgesichert bleibt.
Neben den genannten Vorteilen ist der Schritt zur Energieautarkie in Deutschland nach wie vor komplex und mit erheblichen bürokratischen und regulatorischen Hürden verbunden. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) regelt die entsprechenden Rahmenbedingungen. Zwar wurde die EEG-Umlage für selbst erzeugten und verbrauchten Strom in den letzten Jahren schrittweise gesenkt, doch zahlreiche Abgaben, Netzentgelte und steuerliche Vorgaben bleiben bestehen – und die beeinflussen die Wirtschaftlichkeit von Eigenstromprojekten. Besonders die sogenannte Drittmengenabgrenzung, also die exakte Messung und Abgrenzung von Strommengen, die an Dritte weitergegeben werden, stellt Unternehmen vor Herausforderungen. Ohne ein rechtssicheres Messkonzept drohen Nachzahlungen.
Herausforderungen liegen im Detail
Der Netzanschluss gestaltet sich komplex. Die Einbindung von PV-Anlagen oder BHKWs in bestehende Infrastrukturen erfordert eine präzise Planung sowie eine frühzeitige Abstimmung mit dem jeweiligen Netzbetreiber. Gerade bei größeren Anlagen oder der Versorgung mehrerer Standorte über das öffentliche Netz können die regulatorischen Anforderungen schnell ein kaum zu bewältigendes Ausmaß annehmen.
Auch die Förderlandschaft ist vielschichtig: Zwar existieren zahlreiche Programme auf Bundes- und Landesebene, allerdings sind die Antragsverfahren oft aufwendig. Zudem ändern sich die Förderbedingungen in unregelmäßigen Abständen. Eine professionelle Energieberatung kann dabei helfen, den Überblick zu behalten.
Aufgrund dieser Herausforderungen empfiehlt es sich, beim Einstieg in die Eigenstromversorgung frühzeitig Experten einzubinden. Ihre Arbeit beginnt mit einer detaillierten Analyse des Energieverbrauchs. Damit lassen sich passgenaue Lösungen entwickeln, die technische, wirtschaftliche und regulatorische Aspekte gleichermaßen berücksichtigen. Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg sind die Auswahl der richtigen Technologie, die Integration von Speichern und ein intelligentes Energiemanagementsystem.
Die einmalige Erstellung und Umsetzung neuer Energiekonzepte reicht jedoch nicht aus: Unternehmer müssen sich fortlaufend mit neuen Technologien und sich ändernden gesetzlichen Vorgaben beschäftigen. Um die nötige Expertise nicht kostspielig im eigenen Unternehmen aufbauen zu müssen, sind externe Dienstleister die beste Wahl.
Abschließend lässt sich sagen: Die Eigenstromversorgung bietet produzierenden Unternehmen enorme Chancen, birgt aber auch Risiken. Wer die Stolpersteine kennt und gezielt meistert, kann Kosten sparen und die Weichen für eine nachhaltige und unabhängige Energiezukunft stellen.