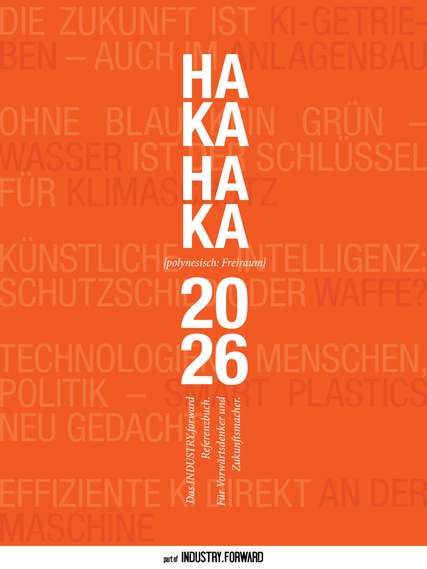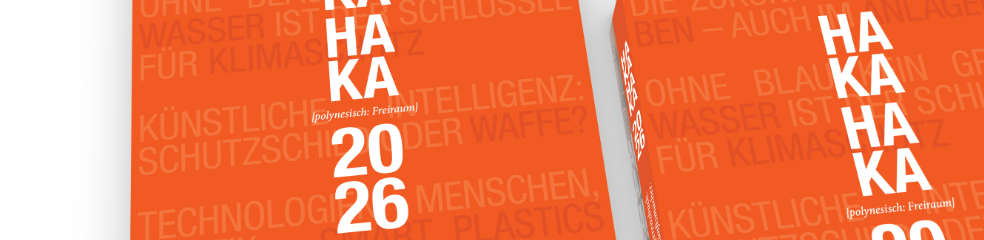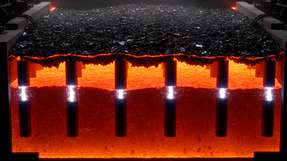Kläranlagen gelten bisher vor allem als Energieverbraucher. Doch sie können mehr. Mit gezielter Flexibilisierung und Unterstützung durch künstliche Intelligenz werden sie zu aktiven Playern im Energiesystem der Zukunft.
Energieflexibilität bedeutet, Stromverbrauch oder -einspeisung bedarfsgerecht zu verändern – und damit gezielt auf Netzanforderungen oder Preisschwankungen zu reagieren. Kläranlagen bringen dafür alle technischen Voraussetzungen mit. Sie vereinen häufig Stromverbraucher (zum Beispiel Pumpen, Rührwerke, Kompressoren), Erzeuger (Blockheizkraftwerke, Photovoltaik) und Speicher (Klärgas in Faultürmen) auf einem Gelände.
Ein aktuelles Beispiel zeigt, wie groß das Potenzial ist. Ein Großklärwerk für rund eine Million Einwohnerwerte wurde detailliert analysiert. Alle 30 untersuchten Prozesse sind in erster Untersuchung technisch flexibel, die meisten dieser Prozesse sind sogar zeitweise unterbrechbar. Selbst die Betreiber waren davon überrascht. Inwiefern diese technische Flexibilität unter praktischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen realisierbar ist, wird im weiteren Projektverlauf untersucht.
Die Umsetzung ist allerdings nach wie vor noch aufwendig. Prozessmodelle müssen sehr genau sein, die Prognosen zuverlässig. Genau hier setzt die Künstliche Intelligenz an. Ein erstes Modell prognostiziert den Abwasserzufluss bereits mit rund 75 Prozent Genauigkeit – mithilfe eines neuronalen Netzes (LSTM). Weitere Prognosen für Strompreise, Wetter oder erneuerbare Einspeisung sollen folgen. Ziel ist ein selbstlernendes System, das die Prozesse laufend optimiert.
Der ökonomische Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Verlagerung von Prozessen, die viel Energie verbrauchen, in günstige Zeiten, zum Beispiel um die Mittagszeit, wenn die Sonnenenergie im Überfluss vorhanden ist, sinken die Betriebskosten. Gleichzeitig kann die Eigenerzeugung aus Klärgas dann eingespeist werden, wenn die Preise hoch sind.
Dabei unterstützt ein praxisnahes Tool. Der Quickcheck, basierend auf 14 standardisierten Seiten, analysiert alle relevanten Prozessdaten. Auf diesem Wege lässt sich das technische Flexibilitätspotenzial schnell und systematisch erfassen, unabhängig vom Standort oder der Größe der Anlage.
Auch weitere system- und netzorientierte Aspekte rücken in den Fokus. Lokale Flexibilitätsmärkte, neue Vertragsmodelle mit Netzbetreibern oder die Teilnahme an Regelenergiemärkten könnten künftig zusätzliche Erlöse ermöglichen. Zwar stehen hier viele Regelungen noch aus, doch die Richtung ist klar: Flexibilität wird wertvoll – lokal wie systemweit. Kläranlagen sind damit weit mehr als Infrastruktur: Denn richtig eingesetzt, werden sie zu Energiepartnern.
Gefördert wird das Vorhaben „FlexAqua“ vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).