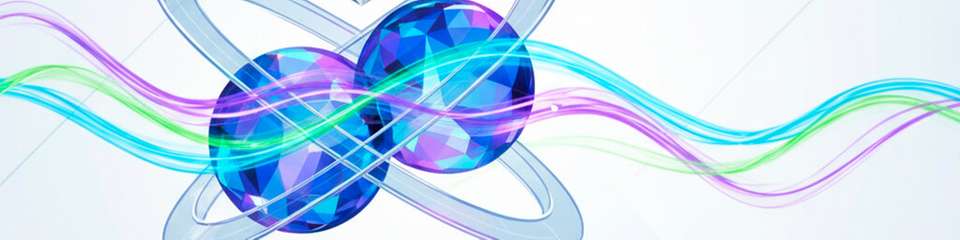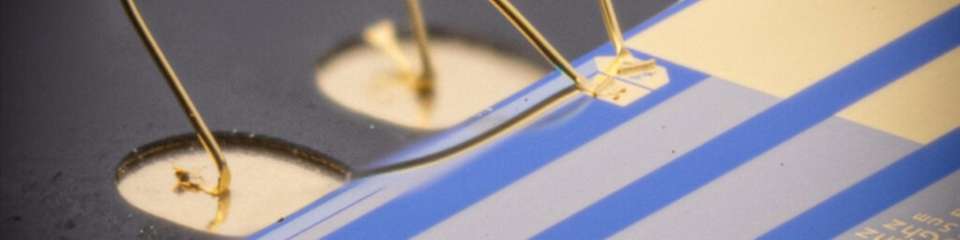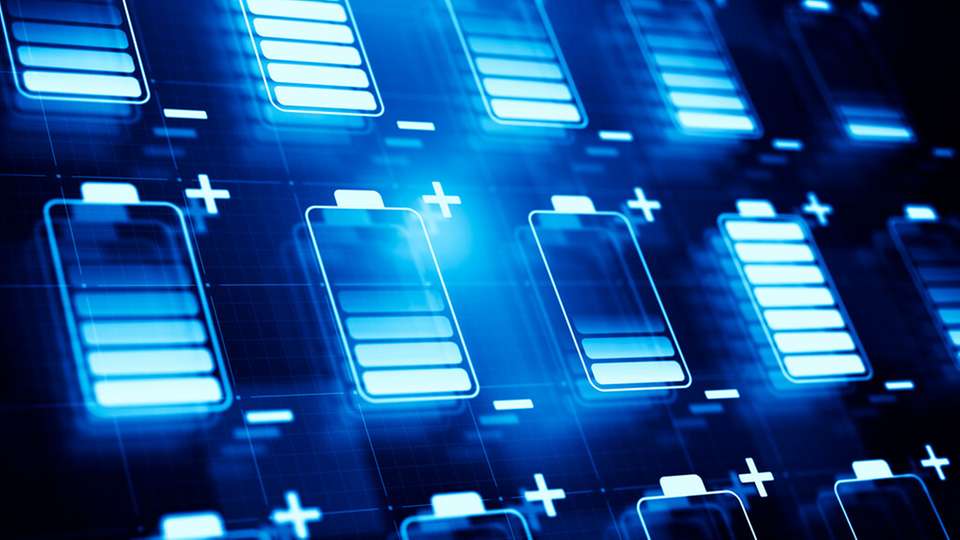Neue Batterien entwickeln und bestehende effektiv recyceln: Diese Ziele verfolgen zwei neue Projekte am Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor und am Institut für Anorganische Chemie der Universität Würzburg. Energiespeicher in Form von Batterien nehmen eine Schlüsselrolle bei der globalen Energiewende ein. Allerdings werden für ihre Herstellung in der Regel wertvolle und teilweise knappe Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Nickel benötigt, deren Abbau oft mit schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt einhergeht. Aus diesem Grund sind das Recycling von Lithium-basierten Batterien einerseits und die Entwicklung alternativer Batterietechnologien andererseits von großer Bedeutung.
Beiden Ansätzen widmen sich zwei neue Forschungsprojekte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Institut für nachhaltige Chemie und Katalyse mit Bor (ICB) und dem Institut für Anorganische Chemie (IAC) der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU). Dafür stellt das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) insgesamt knapp 1,8 Millionen Euro zur Verfügung.
Neue Batterien auf Basis von Borverbindungen
Im Verbundprojekt „Festkörper Natrium-Ionen-Batterien auf Basis von Bor-haltigen Elektrolyten“ (FestNaBor) werden Natrium-Ionen-Feststoffbatterien als alternative Energiespeicher zu Lithium-Ionen-Batterien entwickelt. Anders als Lithium ist Natrium praktisch unbegrenzt verfügbar. Professor Maik Finze und Professor Holger Braunschweig entwickeln hierfür gemeinsam mit ihren Teams effiziente und ressourcenschonende Synthesen für Natrium-Salze mit Borat-Anionen (Natrium-closo-borate).
In Studien wurde gezeigt, dass Natrium-closo-borate sehr stabil sind und eine Natrium-Ionen-Leitfähigkeit im Festkörper aufweisen können. Somit sind sie ideale Kandidaten für den Bau von Natrium-Ionen-Feststoffelektrolyte, die gemeinsam mit Partnern innerhalb des Verbundes in Natrium-Ionen-Feststoffbatterien verwendet werden.
Für das Projekt FestNaBor stellt das BMFTR den Gruppen von Maik Finze und Holger Braunschweig am ICB insgesamt knapp 800.000 Euro zur Verfügung. Am Institut dreht sich alles, um das Element Bor, denn dieses kann eine nachhaltigere Chemie ermöglichen, wobei borhaltige Moleküle vielfältige Aufgaben erfüllen können. Beispielsweise dienen Boratanionen nicht nur als Komponenten von Leitsalzen in Batterien sondern auch in Superkondensatoren oder als Katalysatoren für die umweltfreundliche Synthese von Chemikalien. Das ICB der Uni Würzburg ist 2019 ins Leben gerufen worden und am 31. März 2022 wurde das neue Gebäude des Instituts eingeweiht.
Recycling von Lithium-Ionen-Batterien
Lithium-Ionen-Batterien sind der Stand der Technik bei Elektrofahrzeugen. Wenn die Batterien ihr Lebensende erreichen, entsteht ökologisch bedenklicher Abfall, der aber auch als wertvolle Quelle kritischer Rohstoffe dienen kann.
Im Forschungsvorhaben „Prozesse für das Direkte Recycling von Kathoden aus zyklisierten Lithium-Ionen-Batterien zur Maximierung der rückgewinnbaren Funktionsmaterialien“ (ProBatman) geht es darum, End-of-Life-Batterien vollständig zu recyceln und die einzelnen Komponenten und Materialien möglichst vollständig wieder in den Produktionskreislauf für neue Batterien zu integrieren.
Die Gruppen von Professor Maik Finze und Dr. Guinevere Giffin arbeiten im Verbund mit Partnern aus der Industrie und von Forschungseinrichtungen an der Entwicklung und Optimierung der einzelnen Prozessschritte mit dem Ziel, elementare Bestandteile maximal rückzugewinnen und den CO2-Fußabdruck der Wertschöpfungskette zu verringern.
Förderung und Laufzeit
Das BMFTR fördert die Arbeiten in den Gruppen von Maik Finze und Guinevere Giffin am IAC der JMU zu ProBatman mit mehr als 970.000 Euro. Die Laufzeit für beide Projekte beträgt drei Jahre und geht bis Ende Juni 2028.