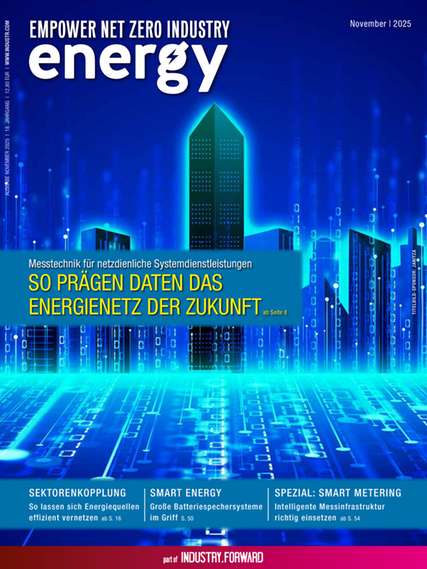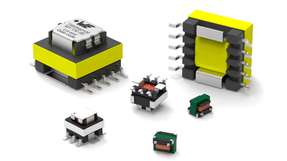Energie sichern, bevor sie fehlt: Unterirdische Wasserstoffspeicher könnten zu Deutschlands neuer Energiereserve werden. Doch der Ausbau stockt, wie TÜV-Nord-Experte Alexander Holle erklärt: Es fehlen klare Vorgaben und der Mut zu Investitionen.
Der Einsatz von Wasserstoff wird ein wichtiger Faktor für die nachhaltige Energieversorgung energieintensiver Branchen in Deutschland sein. Damit künftig jederzeit ausreichend Wasserstoff zur Verfügung steht, ist der Ausbau großer unterirdischer Speicher und der entsprechenden Pipeline-Infrastruktur entscheidend wichtig. „Unterirdische Speichersysteme können aber nicht von heute auf morgen realisiert werden. Die Politik muss deshalb den Weg für Investitionssicherheit ebnen, während Speicherbetreiber in Pilotprojekten bereits jetzt die technischen Herausforderungen angehen“, fordert Alexander Holle, Leiter HydroHub bei der TÜV Nord Group.
Wasserstoff wird eine wichtige Rolle für eine resiliente und klimaneutrale Energieversorgung in Deutschland spielen – insbesondere für die energieintensiven Industriesektoren, die nicht oder nicht wirtschaftlich elektrifiziert werden können. „Auch wenn es aktuell mit dem Markthochlauf nicht so schnell vorangeht, wie vor einigen Jahren erhofft, ist Wasserstoff doch für eine Reihe von Sektoren die beste Option“, betont Holle. „Die Bundesregierung hat zuletzt mit den Entwürfen für das Wasserstoffbeschleunigungsgesetz und das Geothermie-Beschleunigungsgesetz einige wichtige Maßnahmen auf den Weg gebracht. Um rechtzeitig ausreichend Wasserstoff zur Verfügung zu haben, müssen aber jetzt die Voraussetzungen für den Ausbau von Wasserstoffspeichern geschaffen werden.“
Speicher gleichen Schwankungen aus
Untergrundspeicher können im Energiesystem der Zukunft mehrere Zwecke erfüllen:
Als Fluktuationsspeicher: Gespeicherter Wasserstoff kann kurzfristig rückverstromt werden, um Schwankungen im Stromnetz auszugleichen.
Als saisonale Energiespeicher: Erhöhte Energiebedarfe in der Dunkelflaute und im Winter können über den Sommer in Form von Wasserstoff eingespeichert werden.
Als Energiereserve: Als strategische Energieträgerreserve können die großen Wasserstoffspeicher die Versorgung gegen Unsicherheiten äußerer Einflüsse bei Energieimporten und -preisschwankungen absichern.
Als Puffer: Ein flexibler Puffer kann die gleichmäßige Auslastung weiterer Infrastrukturen wie Importterminals oder Leitungen sicherstellen.
Während kurzfristige Schwankungen im Netz auch durch Druckveränderungen über das Pipelinesystem oder andere Speichermethoden wie zum Beispiel Batteriespeicher ausgeglichen werden können, erfordern alle anderen Anwendungen sowohl langfristige als auch großvolumige Speicher, um den gewünschten Effekt zu erreichen. Für diese Zwecke sind Wasserstoffspeicher unter der Erde besonders geeignet, da hier große Energiemengen über lange Zeiträume gespeichert werden können und dann für die Strom- sowie Wärmeerzeugung ebenso wie für andere industrielle Prozesse eingesetzt werden können.
Salzkavernen sind besonders geeignet
Technisch am besten geeignet sind Salzkavernen, da sie chemisch reaktionsträge und geologisch langzeitstabil sind. Es können sowohl bestehende Kavernen umgerüstet werden als auch neue entstehen. „In Norddeutschland befinden sich sehr große unterirdische Salzvorkommen, ein Alleinstellungsmerkmal in Europa, sodass diese Region prädestiniert ist für die Errichtung von Wasserstoffspeichern“, erklärt Alexander Holle.
Industrieller Bedarf bestimmt nötige Kapazität
Wie viel Speicherkapazität in Zukunft benötigt wird, richtet sich vor allem nach dem Wasserstoffverbrauch durch Großverbraucher wie die Energieerzeugung und die Industrie. Die Langfristszenarien des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie prognostizieren hier einen sprunghaften Anstieg: Bis 2035 wird ein Bedarf von jährlich 17 TWh erwartet, bis 2040 jedoch bereits 55 TWh. Grund dafür ist die Einführung von Wasserstofftechnologien in Kraftwerken und Großindustrien in diesem Zeitraum. Bis 2045 wird ein Bedarf von bis zu 80 TWh pro Jahr angenommen.
Unsichere Marktlage erschwert Investitionsentscheidungen
Im Kraftwerke und Großindustrien auf Wasserstoff umzustellen, müssen zu diesem Zeitpunkt Speicher vorhanden sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass Wasserstoff ganzjährig zuverlässig verfügbar ist. „Aktuell sehen wir aber eine große Unsicherheit im Markt, da nicht klar ist, wie sich die Energiewende und die Transformation der Industrie auf europäischer Ebene entwickelt. Für viele großvolumige Speicherprojekte gibt es deshalb noch keine finale Investitionsentscheidung“, sagt Alexander Holle. „Kavernen umzuwidmen oder neu zu schaffen, dauert jedoch außerordentlich lang, sodass die Investitionsentscheidungen 2026 oder 2027 getroffen werden müssen, um die nötigen Kapazitäten zu erreichen.“
Die Umwidmung bestehender Kavernen dauert etwa vier bis sechs Jahre, der Neubau etwa zehn bis zwölf Jahre. Bei der Umwidmung von Kavernen sind die zentralen Herausforderungen die Anpassung der obertägigen Anlagenteile an Wasserstoff und die Genehmigungsprozesse. Beim Neubau von Kavernen verlängert sich der Zeitraum erheblich durch die notwendige Zeit für die sogenannte Solung der Kavernen im Salzstock. Dabei wird Wasser in den Salzstock geleitet, das das Salz löst und so einen Hohlraum schafft.
Technische Herausforderungen noch offen
Es sind noch viele technische Fragen ungelöst, beispielsweise zur Gasreinigung, zur Materialeignung oder zur Bruchfestigkeit unter steigendem Druck. Im Rahmen von Pilot- und Demonstrationsprojekten werden die offenen technischen Fragestellungen aktuell angegangen. Die daraus entstehende Standardisierung und Normung von Materialien oder Verfahren kann den Bau von Speichern signifikant vereinfachen. Daher ist die Unterstützung dieser Projekte für den Hochlauf essenziell.
„Die Bundesregierung muss jetzt klare Rahmenbedingungen für den Ausbau der Speicherinfrastruktur schaffen und ein Zielbild für deren Rolle im europäischen Energiesystem formulieren. Zudem sollten Investitionsanreize für die Umrüstung und den Neubau von Kavernen geschaffen werden“, sagt Wasserstoff-Experte Alexander Holle.