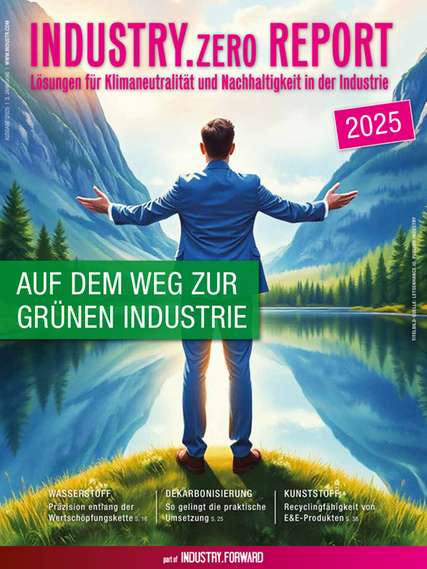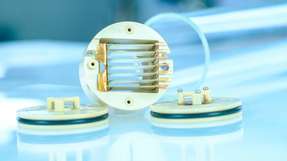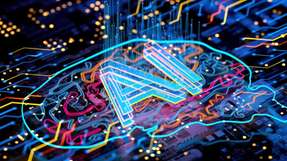Erfolgsgeschichte mit angezogener Handbremse – so lässt sich die Entwicklung der Photovoltaik seit der Einführung des EEG im Jahr 2000 zusammenfassen. Ursprünglich schufen feste Einspeisevergütungen, unkomplizierte Genehmigungen und garantierte Laufzeiten ein attraktives Umfeld für Investoren und Projektierer. Die Branche wuchs rasant, wurde professioneller und internationaler und entwickelte sich zu einem der Pfeiler der Energiewende.
Inzwischen verkomplizieren jedoch langwierige Genehmigungsverfahren, kleinteilige Regelwerke und föderale Unterschiede den weiteren Ausbau. Projektentwickler müssen sich durch ein Dickicht aus Vorgaben, unklaren Zuständigkeiten und widersprüchlichen Anforderungen navigieren – auch bei der Finanzierung. Oftmals verlängern sich die Prozesse um Jahre, da Bauleitpläne angepasst, Umweltgutachten erstellt und Einspeisepunkte mühsam mit Netzbetreibern verhandelt werden müssen. Auf politischer Seite fehlt es häufig an Koordination und digitalen Strukturen. So bleibt trotz klarer politischer Zielvorgaben und steigender Nachfrage nach grünem Strom viel Potenzial ungenutzt.
Ausschreibungen: Flaschenhals statt Wettbewerb
Anstelle fixer Vergütungssätze dominiert inzwischen ein komplexes Ausschreibungsdesign den Zugang zum Solarmarkt. Ziel war ursprünglich die Förderung eines wettbewerbsfähigen Preisdrucks. Doch die Realität sieht anders aus: Kleine und mittelständische Projektentwickler geraten ins Hintertreffen, während kapitalkräftige Großkonzerne dominieren. Parallel erschwert die Vielzahl an Ausschreibungsrunden und Fristen eine strategische Projektplanung. Laufende Regeländerungen verunsichern – der Markt braucht Verlässlichkeit, keine regulatorisches Roulette.
Ein weiteres Problem liegt in der strukturellen Ungleichbehandlung verschiedener Anlagetypen. Während größere Projekte auf schwankende Börsenpreise und Direktvermarktung setzen müssen, speisen Kleinstanlagen weiterhin zu festen Sätzen ein. In besonders sonnenreichen Stunden entsteht ein massives Überangebot, das den Marktpreis ins Negative drückt. Betreiber großer Anlagen reagieren, drosseln und stoppen Einspeisungen – oft auf Kosten der Rentabilität. Gleichzeitig fließt Solarstrom aus Kleinanlagen ungebremst ins Netz, staatlich geschützt durch frühere EEG-Zusagen. Dieser Mechanismus verzerrt den Markt und benachteiligt Effizienz beziehungsweise Größe. Während große Projekte technologische Spitzenleistungen liefern, profitieren andere weiterhin vom Bestandsschutz.
Finanzwirtschaft gefordert
Der Wandel im Vergütungssystem verändert auch die Finanzierungslandschaft. Klassische Bankdarlehen mit hoher Fremdkapitalquote weichen zunehmend projektbasierten Modellen mit detaillierten Risikoanalysen. Projektierer benötigen heute belastbare Direktvermarktungskonzepte, langfristige Stromabnahmeverträge (PPAs) und flexible Einspeisesteuerung. Nur so entstehen kalkulierbare Einnahmen. Viele PPAs laufen jedoch nur über wenige Jahre und bieten vergleichsweise niedrige Vergütungsätze.
Gleichzeitig verlangt der Markt eine ständige Reaktionsfähigkeit auf volatile Preise. Ein Großteil der Banken folgt jedoch immer noch alten Denkmustern. Selbst bei stabilen Marktbedingungen und professionellen Betriebsmodellen gelten PV-Projekte bei ihnen oft als Blankokredite – aufgrund des Mangels an belastbaren Garantievergütungen. Anstatt sich mit Chancen, Risiken und der Qualität der Akteure auseinanderzusetzen, ziehen sich Kreditinstitute auf veraltete Denkmuster zurück.
Photovoltaikprojekte gelten bis heute weitgehend als nicht bewertbar und werden somit bei der Finanzierung als „Blankokredite“ ausgereicht – ein Unding, wenn man bedenkt, dass bis zur Baureife eines Projekts viele Genehmigungshürden genommen werden müssen und aus einer „sauren Wiese“ letztlich ein Grundstück mit Betriebs- und Einspeiserecht wird. Eine echte Einschätzung des Geschäftsmodells sowie eine marktgerechte Bewertung bleiben oft aus. Diese Zurückhaltung bremst nicht nur Projekte, sondern verschenkt Potenziale. Die Finanzwirtschaft steht in der Verantwortung, mit der Branche Schritt zu halten und ihre Rolle als Ermöglicher der Energiewende neu zu denken.
Klarheit statt Komplexität
Projektentwickler fordern längst mehr als bloßen Fördernachlass. Erwartet wird ein verlässlicher Ordnungsrahmen – technologieoffen, marktwirtschaftlich und investitionsfreundlich. Notwendig sind gleiche Einspeisebedingungen für alle Anlagengrößen, weniger Planungshemmnisse und digitalisierte Genehmigungsprozesse. Erste politische Ansätze wie Leistungsbegrenzungen für neue Kleinanlagen oder Reformen beim Netzausbau greifen Symptome auf – das Grundproblem bleibt jedoch ungelöst: Intransparenz und Überregulierung hemmen die Dynamik. Was fehlt, ist ein stabiles Spielfeld, auf dem alle Akteure zu vergleichbaren Bedingungen agieren können. Nur so entsteht Vertrauen – und nur so lassen sich die ambitionierten Ausbauziele der kommenden Jahre tatsächlich erreichen.
Energiewende braucht Entfesselung
Photovoltaik steht heute nicht mehr am Anfang – sondern ist bereit für die Unabhängigkeit von Fördergeldern. Technologien, Know-how und Kapital sind vorhanden. Was fehlt ist die politische Bereitschaft, Altlasten abzubauen und neue Regeln aufzustellen. Energiepolitik darf nicht länger in Formularen und Paragrafen steckenbleiben. Beschleunigung beginnt mit Mut zur Vereinfachung – und mit dem Vertrauen in unternehmerische Lösungen. Solange faire Rahmenbedingungen fehlen, bleiben selbst ehrgeizigste Klimaziele Wunschdenken. Weitere Informationen können Sie hier finden!