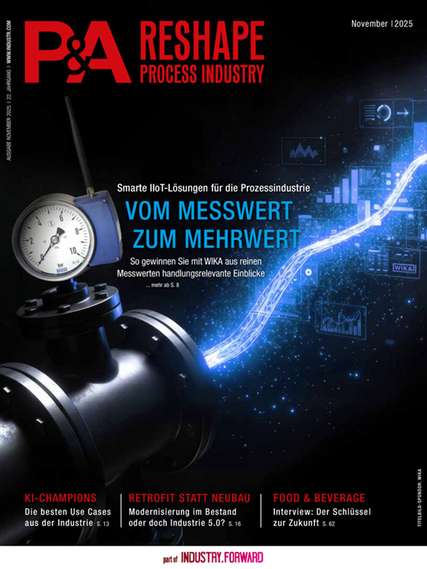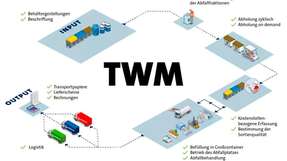Die aktuelle Studie von Plastics Europe zeigt: 2023 wurden allein in Europa circa 54 Millionen t Kunststoffe produziert, wobei nur ungefähr 20 Prozent der Eingangsstoffe aus recyceltem Material bestanden. Nicht die einzigen, aber wichtige Gründe für diese geringe Wiederverwertungsquote sind die nicht ausreichenden Sortierkapazitäten, die zur Trennung der Kunststoffarten erforderlich sind. Die Sortierung ist notwendig, um bei mechanischen Recyclingverfahren die Qualität der erhaltenen Produkte sicherzustellen. Auch sind mit Additiven versetzte Kunststoffe oder auch Verbundmaterialen problematisch, da diese sich nur schwer trennen lassen und sich deshalb mit herkömmlichen Verfahren kaum recyceln lassen. Angesichts zu erwartender regulatorischer Anforderungen stehen die Hersteller von Kunststoffprodukten damit zunehmend unter Druck. Denn sie haben sich darauf einzustellen, dass ihre Kunststoffe perspektivisch einen gewissen Anteil an Rezyklaten enthalten müssen.
Chemisches Kunststoffrecycling als Lösung und Herausforderung
Vor diesem Hintergrund gewinnt das chemische Kunststoffrecycling an Bedeutung; Hierbei wird der Plastikmüll zur weiteren Verarbeitung zum Beispiel durch einen Pyrolyseprozess zunächst in seine Grundbestandteile aufgespalten. Viele der erhaltenen Stoffe, wie beispielsweise Öl und Gas, können dann fossile Rohstoffe in der Kunststoffproduktion ersetzen oder zur Energiegewinnung genutzt werden.
Das chemische Recycling ermöglicht es, Materialien wieder in den Stoffkreislauf rückzuführen, also eine Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Altplastik wird damit zu einer wertvollen Ressource und zu einem Schlüsselelement auf dem Weg zur Einhaltung der Nachhaltigkeitsziele.
Dass sich das chemische Recycling dennoch nur zögerlich durchsetzt, liegt neben dem Marktumfeld an den charakteristischen Herausforderungen, die entsprechende Verfahren und Technologien stellen. Insbesondere geht es darum, Prozesse in Recycling und Weiterverarbeitung so anzupassen und zu optimieren, dass das Endprodukt die geforderten hohen Qualitätsstandards dauerhaft erfüllt.
Flexibilität im Engineering, Betrieb und Scale-up
Eine wirkungsvolle Hilfestellung beim Erarbeiten von Lösungen für diese komplexe Fragestellung bieten der Digitale Zwilling (Digital Twin) und flexibel anpassbare Prozessleitsysteme. Mit dem Digitalen Prozesszwilling lässt sich das Prozess-Layout schon vorab in der Software simulieren und skalieren, sodass eventuelle Fehler bereits in der virtuellen Welt behoben und damit in der Realität vermieden werden können. Unabhängig davon, ob es darum geht, eine neue Anlage zu planen, eine bereits bestehende aufzurüsten oder zu erweitern – der digitale Zwilling reduziert die Risiken der Umsetzung und ermöglicht später einen einfachen Ausbau, auch hinsichtlich Reproduzierbarkeit und Modularisierung. Ist eine Anlage bereits im Betrieb, sorgt das parallele Engineering von Änderungen dafür, dass mit realen Daten vorausgeplant wird, ohne den laufenden Betrieb zu stören.
„In den vergangenen Jahren sind viele Anlagen entstanden, die innovative Verfahren des chemischen Recyclings anwenden, um aus vermeintlichen Abfällen wieder wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Den Unternehmen, die wir begleiten, ist vor allem daran gelegen, ihre Prozesse von einem Labormaßstab in die kommerzielle Reife zu überführen, in einem nächsten Schritt zu skalieren und an verschiedenen Standorten zu realisieren“, erklärt Jürgen Giegerich, bei Siemens Digital Industries Leiter des Vertriebs für die chemische Industrie in Deutschland. „Wir unterstützen diese Unternehmen mit dem Digitalen Zwilling, der fortlaufende Prozessoptimierungen ermöglicht und Automatisierungs-, Simulations- und Prozessleittechnik miteinander verbindet.“
Auf Ebene der Leittechnik kommt in vielen Projekten das webbasierte und intuitiv bedienbare Leitsystem Simatic PCS neo zum Einsatz. Es zeichnet sich durch eine offene Architektur aus, in der modulares Engineering mit der Unterstützung von Module Type Packages (Unterstützung des offenen MTP-Standards) fest integriert ist. Anlagenmodule können dadurch noch einfacher in das Prozessleitsystem integriert sowie herstellerunabhängig projektiert werden. Das System zeichnet sich durch höchste Skalierbarkeit aus und ist für die Automatisierung kleiner Prozessmodule genauso geeignet wie auch für größte Anlagen. Möglich wird dies durch eine maximale Wiederverwendbarkeit der Engineeringlösungen für ein einfaches Scale-up und die Anpassung an unterschiedliche Anlagengrößen. Ein Fernzugriff auf weltweit verteilte Standorte ist über das webbasierte System ebenso möglich wie eine Schulung der Anlagenfahrer am virtuellen Zwilling.
Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette
Die kontinuierliche Steuerung und Überwachung des Prozesses sind der Schlüssel für die gleichbleibende Qualität des Rezyklats. Ein innovatives Beispiel hierfür ist die Technologie des britischen Unternehmens Plastic Energy, das eine thermische anaerobe Konversion (TAC) entwickelt hat. In diesem Verfahren wird Kunststoffabfall in sauerstofffreier Umgebung erhitzt und zu TACOIL umgewandelt – einem synthetischen Öl, das als Rohstoff für die Herstellung neuer Kunststoffe verwendet werden kann. TACOIL lässt sich sogar für die Produktion lebensmittelgeeigneter Verpackungen nutzen und kann fossile Rohstoffe in petrochemischen Anlagen vollständig ersetzen. Plastic Energy betreibt kommerzielle Anlagen in Spanien, Frankreich und den Niederlanden und arbeitet eng mit Partnern aus der Petrochemie zusammen, um die Outputqualität der synthetischen Öle an die Anforderungen moderner Crackanlagen anzupassen.
Ein entscheidender Erfolgsfaktor für die Qualität des aus Plastik gewonnenen recycelten Rohstoffs, die Effizienz und Skalierbarkeit der TAC-Anlagen ist dabei die Integration von Automatisierungs- und Steuerungslösungen von Siemens. Das Leitsystem ermöglicht hier nicht nur eine durchgängige Anlagensteuerung, sondern auch eine vorausschauende Analyse des Inputmaterials, das je nach Zusammensetzung stark variieren kann. Durch intelligente Steuerstrategien können Störungen frühzeitig erkannt und vermieden werden, was die Betriebssicherheit erheblich erhöht. Darüber hinaus helfen Softwaremodule zur Verwaltung von Feldgeräten und Wartung dabei, die Anlagenverfügbarkeit zu optimieren.
In einem weiteren Beispiel arbeitet Prozessleittechnik aus der Simatic-Welt gleich an zwei Stellen einer nachhaltigen Wertschöpfungskette: bei der Pyrum Innovations AG, die per Pyrolyse aus alten Autoreifen sekundäre Rohstoffe gewinnt, und bei BASF, die das Pyrolyseöl von Pyrum parallel zu konventionellen Rohstoffen in die Produktion einspeist und nach dem Prinzip der Massebilanz hochwertigem Kunststoffmaterial unter anderem für den Textilhersteller VAUDE zuweist.
„Ein Digitaler Zwilling und smarte Prozessleittechnik helfen auch den Chemieunternehmen, die zunehmend zirkuläre, also recyclierte, Rohstoffe verwenden: diese alternativen Rohstoffe stellen andere Anforderungen an die Prozessführung als konventionelle, erdölbasierte Produkte. Anpassungen des Prozesses können im Digitalen Zwilling durchgespielt werden, bevor sie in die Realität umgesetzt werden. Und nicht nur der Einsatz der alternativen Rohstoffe ist Teil der Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen: Auch Energieverbräuche können im Rahmen der Simulation direkt optimiert werden“, führt Jürgen Giegerich weiter aus.
Elektrische Schalt-Komponenten aus recyceltem Kunststoff
Siemens unterstützt Zirkularität in der Kunststoff- und kunststoffverarbeitenden Industrie aber nicht nur auf der Automations- und Digitalisierungsseite, sondern auch als Abnehmer entsprechender Produkte. Aktuell betrifft dies vor allem elektrische Schaltkomponenten, die die auf Niederspannungsverteilung spezialisierte Business Unit Electrical Products unter dem Dach von Siemens Smart Infrastructure in eigenen Werken weltweit herstellt. Um die hohen Sicherheitsstandards in der elektrischen Schalt- und Installationstechnik zu erfüllen, sind viele dieser Produkte mit Gehäusen und Funktionsteilen aus technischen Kunststoffen wie Polyamiden (PA) oder Polybutylenterephtalat (PBT) ausgestattet.
Im Juni 2024 haben Siemens Smart Infrastructure und BASF gemeinsam das erste elektrische Sicherheitsprodukt vorgestellt, das Komponenten aus biomassenbilanzierten Kunststoffen enthält. Der in Industrie- und Infrastrukturanwendungen eingesetzte Siemens-Leistungsschalter Sirius 3RV2 wird jetzt mit teils flammgeschützten und UL zertifizierten Produkten Kunststoffen aus den BASF Produktfamilien Ultramid BMBcert (PA) und Ultradur BMBcert (PBT) hergestellt. Dafür ersetzt BASF fossile Rohstoffe am Anfang der Wertschöpfungsketten durch Bio-Methan aus nachwachsenden Quellen wie landwirtschaftlichen Abfällen. Beide Materialien bieten die gleiche hervorragende Qualität und Leistungsfähigkeit wie die bewährten Kunststoffe von BASF, die bisher für die Fertigung der Komponenten für den Sirius 3RV2 eingesetzt wurden. Durch die Umstellung in der Produktion des Leistungsschalters Sirius 3RV2 werden rund 270 t Kohlendioxid-Äquivalente pro Jahr eingespart (Die Berechnung des Product Carbon Footprint von Materialien erfolgt nach der TfS-Methodik. Dabei wird die CO2-Reduktion des biomassenbilanzierten BASF-Produkts mit der des herkömmlichen BASF-Produkts verglichen).
Im Februar 2025 folgte dann mit dem Sentron 5SV3 Fehlerstromschutzschalter Typ A/AC das erste Produkt, für das Siemens TECHNYL 4EARTH von Domo Chemicals verwendet. Dieses leistungsstarke Polyamid besteht zu 50 Prozent aus recycelten Rohstoffen, darunter chemisch recyceltes PA6 aus verschiedenen postindustriellen und Post-Consumer-Quellen wie Fasern und Textilfilamenten. Das Material ist außerdem flammgeschützt und UL-zertifiziert und bietet die gleiche Qualität und Leistungsfähigkeit wie herkömmliche Kunststoffe - eine Grundvoraussetzung bei einem Sicherheitsprodukt wie diesem.
Nachhaltigkeit bei Siemens
Der Leistungsschalter Sirius 3RV2 und der Sentron-5SV3-Fehlerstromschutzschalter Typ A/AC erfüllen die strengen Kriterien des 2024 eingeführten Siemens EcoTech-Labels, das Kunden einen umfassenden und transparenten Einblick in die Produktleistung hinsichtlich ausgewählter Umweltkriterien gibt. Für die Zukunft plant Siemens, den Einsatz nachhaltiger Materialien sukzessive auf weitere Produkte im Portfolio auszuweiten.
Ergänzt wird dieser Ansatz durch konkrete Ansätze im End-of-life-Management der produzierten Plastikprodukte. Um die Recyclingfähigkeit der Kunststoffanteile aus Elektro- und Elektronikgeräten zu erhöhen, hat Siemens deshalb 2023 eine Studie am IKK – Institut für Kunststoff- und Kreislauftechnik initiiert. Sie trägt dazu bei, das „Design for Recycling“ zu verbessern und die Zirkularität zahlreicher Produkte im Bereich von Elektro- und Elektronikprodukten (E&E) zu erhöhen.
Damit unterstützt das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele in den Bereichen Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz. Denn neben Produktdesign und -funktionen sowie Fertigungs- und Zulieferprozessen spielt die Auswahl der Materialien eine große Rolle, um CO2-Emissionen noch weiter zu reduzieren und natürliche Ressourcen zu schonen. Insgesamt verfolgt Siemens ein wissenschaftlich fundiertes 1,5°-C-Dekarbonisierungsziel – einschließlich des Ziels der Reduzierung von Emissionen von Scope 1 und 2 um 90 Prozent bis 2030 – sowie die Anwendung eines robusten Ökodesigns für 100 Prozent der relevanten Produktfamilien bis 2030.
Aufbauend auf dem 2008 eingeführten Umweltportfolio, der systematischen Integration ökologischer Design-Prinzipien mit dem Siemens Robust Eco Design-Ansatz ab 2020 und dem 2021 eingeführten DEGREE-Rahmenwerk – das einen 360-Grad-Ansatz für zentrale Nachhaltigkeitswerte mit klaren Zielen in den sechs Bereichen Dekarbonisierung, Ethik, Unternehmensführung, Ressourceneffizienz, Vielfalt, Inklusion und Gemeinschaft sowie Mitarbeiterbefähigung bietet – bleibt Siemens weiterhin Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit.