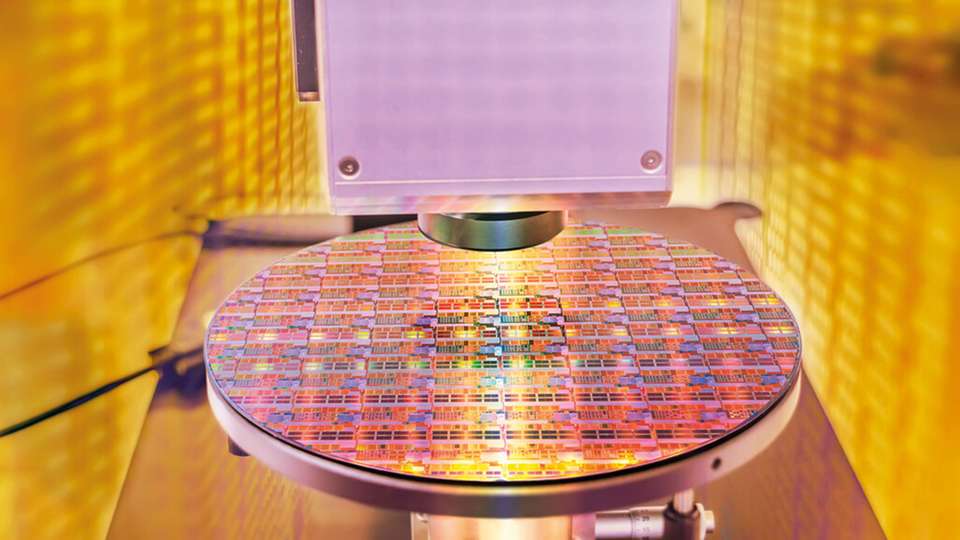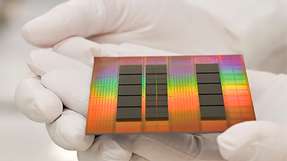Siliziumhalbleiter, die in bestehenden Photodetektoren verwendet werden, weisen eine geringe Lichtempfindlichkeit auf, und der zweidimensionale Halbleiter MoS2 (Molybdändisulfid) ist so dünn, dass Dotierungsprozesse zur Steuerung seiner elektrischen Eigenschaften schwierig sind, was die Realisierung von Hochleistungs-Photodetektoren einschränkt. Das KAIST-Forschungsteam hat diese technische Einschränkung überwunden und den weltweit leistungsstärksten selbstversorgenden Photodetektor entwickelt, der ohne Strom in Umgebungen mit einer Lichtquelle funktioniert. Dies ebnet den Weg für eine Ära, in der präzise Sensorik ohne Batterien in tragbaren Geräten, bei der Überwachung von Biosignalen, in IoT-Geräten, autonomen Fahrzeugen und Robotern möglich ist, solange eine Lichtquelle vorhanden ist.
Das KAIST gab bekannt, dass das Forschungsteam von Professor Kayoung Lee von der Fakultät für Elektrotechnik einen selbstversorgenden Photodetektor entwickelt hat, der ohne externe Stromversorgung funktioniert. Dieser Sensor zeigte eine bis zu 20-mal höhere Empfindlichkeit als bestehende Produkte und erreicht damit das höchste Leistungsniveau unter den bisher bekannten vergleichbaren Technologien.
PN-Übergang ohne klassische Dotierung ermöglicht neue Sensortechnik
Das Team von Professor Kayoung Lee stellte einen Photodetektor mit „PN-Übergangsstruktur“ her, der in Umgebungen mit Licht selbst ohne Stromversorgung elektrische Signale erzeugen kann, indem es eine „Van-der-Waals-Bodenelektrode“ einführte, die Halbleiter ohne Dotierung extrem empfindlich für elektrische Signale macht. Zunächst einmal ist ein „PN-Übergang“ eine Struktur, die durch die Verbindung von p-Typ-Materialien (lochreich) und n-Typ-Materialien (elektronenreich) in einem Halbleiter entsteht. Diese Struktur bewirkt, dass bei Lichteinfall Strom in eine Richtung fließt, was sie zu einer Schlüsselkomponente in Photodetektoren und Solarzellen macht.
Normalerweise ist zur Herstellung eines geeigneten PN-Übergangs ein Prozess namens „Dotierung“ erforderlich, bei dem dem Halbleiter gezielt Verunreinigungen zugeführt werden, um seine elektrischen Eigenschaften zu verändern. Zweidimensionale Halbleiter wie MoS2 sind jedoch nur wenige Atome dick, sodass eine Dotierung auf herkömmliche Weise die Struktur beschädigen oder die Leistung beeinträchtigen kann, was die Herstellung eines idealen PN-Übergangs erschwert.
Van-der-Waals-Elektroden sichern Stabilität und höchste Empfindlichkeit
Um diese Einschränkungen zu überwinden und die Leistung des Bauelements zu maximieren, entwickelte das Forschungsteam eine neue Bauelementstruktur, die zwei Schlüsseltechnologien umfasst: die „Van-der-Waals-Elektrode“ und das „Partial Gate“. Die „Partial-Gate“-Struktur legt ein elektrisches Signal nur auf einen Teil des zweidimensionalen Halbleiters an und steuert so, dass sich eine Seite wie p-Typ und die andere wie n-Typ verhält. Dadurch kann das Bauelement elektrisch wie ein PN-Übergang ohne Dotierung funktionieren.
Da herkömmliche Metallelektroden chemisch stark an den Halbleiter binden und dessen Gitterstruktur beschädigen können, wurde die „Van-der-Waals-Bodenelektrode“ mithilfe von Van-der-Waals-Kräften schonend angebracht. Dadurch blieb die ursprüngliche Struktur des zweidimensionalen Halbleiters erhalten und gleichzeitig wurde eine effektive Übertragung elektrischer Signale gewährleistet. Dieser Ansatz sicherte sowohl die strukturelle Stabilität als auch die elektrische Leistung und ermöglichte die Realisierung eines PN-Übergangs in dünnen zweidimensionalen Halbleitern, ohne deren Struktur zu beschädigen.
Mit dieser Entwicklung gelang es dem Team, einen leistungsstarken PN-Übergang ohne Dotierung zu realisieren. Das Gerät kann elektrische Signale mit extremer Empfindlichkeit erzeugen, solange Licht vorhanden ist, auch ohne externe Stromquelle. Seine Lichtempfindlichkeit (Responsivität) übersteigt 21 A/W und ist damit mehr als 20-mal höher als bei herkömmlichen Sensoren mit Stromversorgung, 10-mal höher als bei selbstversorgten Sensoren auf Siliziumbasis und mehr als doppelt so hoch wie bei bestehenden MoS₂-Sensoren. Diese Empfindlichkeit bedeutet, dass es sofort in hochpräzisen Sensoren eingesetzt werden kann, die Biosignale erkennen oder in dunklen Umgebungen arbeiten können.
Professor Kayoung Lee erklärte, dass sie „eine Empfindlichkeit erreicht haben, die bei Siliziumsensoren unvorstellbar ist, und obwohl zweidimensionale Halbleiter für herkömmliche Dotierungsverfahren zu dünn sind, ist es ihnen gelungen, einen PN-Übergang zu implementieren, der den Stromfluss ohne Dotierung steuert.“ Sie fügte hinzu: „Diese Technologie kann nicht nur in Sensoren, sondern auch in Schlüsselkomponenten eingesetzt werden, die den Stromfluss in Smartphones und elektronischen Geräten steuern, und bildet damit die Grundlage für die Miniaturisierung und den autarken Betrieb von Elektronikgeräten der nächsten Generation.“