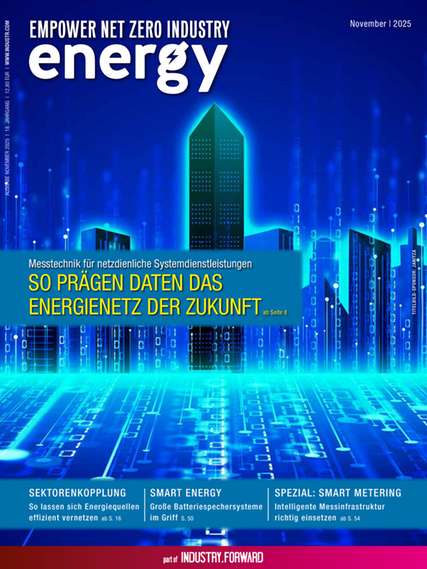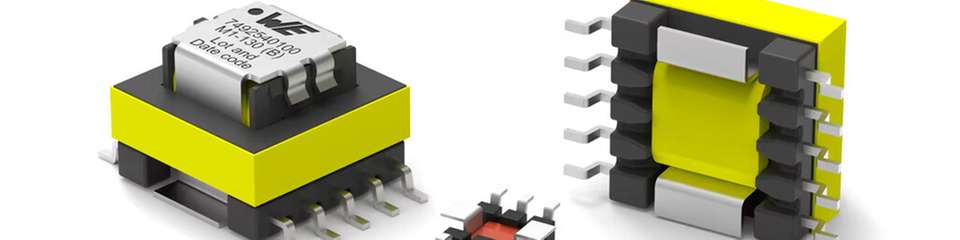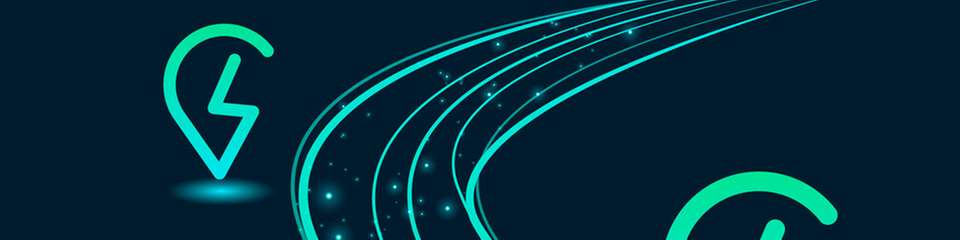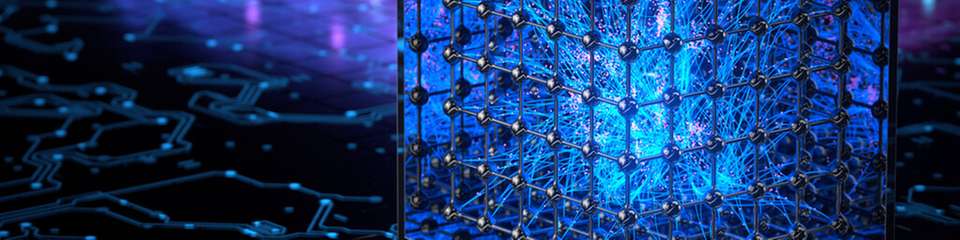Laut dem Erneuerbare-Energien-Gesetz soll der deutsche Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2030 auf 750 TWh steigen. Ausgehend von 510 TWh im Jahr 2023 bedeutet dies ein jährliches Wachstum von knapp sechs Prozent. Gleichzeitig stehen Energieversorger unter großem Druck, möglichst schnell vollständig auf erneuerbare Erzeugung umzusteigen und verschärfte Regularien einzuhalten. Neue Technologien – sowohl auf Hardware- als auch auf Software-Ebene – werden unabdingbar sein, um diese doppelte Herausforderung zu meistern. 2025 werden wir daher einige spannende Entwicklungen im Energiesektor sehen. Das Energiemanagementunternehmen Eaton stellt drei Top-Trends vor:
Umsetzung des SF6-Verbots gehört zum Pflichtprogramm
Zu den einschneidendsten Änderungen in Europa gehört in diesem Jahr die überarbeitete F-Gas-Verordnung der EU, die im Januar 2026 in Kraft tritt und die Verwendung von Schwefelhexafluorid (SF6 ) und anderen F-Gasen in allen neuen Mittelspannungsschaltanlagen bis einschließlich 24 kV verbietet. SF6 hat ein 24.300-mal höheres Treibhauspotenzial als CO2, ist aber aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften seit langem ein fester Bestandteil von elektrischen Schaltanlagen. Im Jahr 2018 wurden nach Untersuchungen der US-Umweltschutzbehörde (EPA) weltweit mehr als 9.000 Tonnen SF6-Abfälle emittiert, was einem CO2-Äquivalent von knapp 219 Millionen Tonnen entspricht – zum Vergleich:
Die in CO2-Äquivalente umgerechneten Gesamttreibhausgasemissionen (inklusive Industrie, Heizen, Verkehr) Deutschlands wurden für das Jahr 2023 mit 674 Millionen t angegeben. Die Energiewirtschaft ist für einen großen Teil der weltweiten SF6-Emissionen verantwortlich. In Europa wird sich diese Situation durch die neue EU-Verordnung ändern, und es ist wahrscheinlich, dass auch Versorgungsunternehmen außerhalb der EU von SF6-freien Alternativen profitieren werden. Diese haben neben den positiven Umweltauswirkungen noch weitere Vorteile wie einen geringeren Wartungsbedarf.
Netzmodernisierung muss jetzt schnell erfolgen
Initiativen zur Emissionsreduktion und der Anstieg von energieintensiver KI-Rechenzentren setzen die Stromnetze immens unter Druck. McKinsey & Company geht davon aus, dass der Strombedarf in Europa bis 2030 in allen Regionen jährlich um ein bis sieben Prozent steigen wird, wobei bis zum Ende des Jahrzehnts bis zu fünf Prozent auf Rechenzentren entfallen werden. Versorgungsunternehmen müssen sich mit Erzeugungsengpässen, Spannungsinstabilitäten und den Herausforderungen der alternden Infrastruktur auseinandersetzen, um auf diese steigende Nachfrage zu reagieren. Bis zum Ende des Jahrzehnts stehen große Entscheidungen und schwierige Weichenstellungen an.
Die Modernisierung des Netzes erfordert gezielte Investitionen zur Unterstützung der Integration dezentraler Energieressourcen, fortschrittlicher Automatisierung sowie einer Vielzahl von Energiespeicherlösungen, sowohl im Endverbrauchermarkt als auch netzdienliche Stromspeicher. Das Ergebnis werden widerstandsfähigere Energienetze sein, die in der Lage sind, verschiedene Energieflüsse zu bewältigen, und damit resilienter gegenüber Ausfällen werden. Digitalisierung spielt bei der Modernisierung der Netze eine entscheidende Rolle, zum Beispiel in Form von digitalen Netzstationen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Analyse-Tools können Versorgungsunternehmen Engpässe besser bewältigen und bestehende Infrastrukturen möglichst effizient nutzen. Es wird erwartet, dass sich der Markt für prädiktive Analysen bis Ende 2026 vervierfachen wird, verglichen mit dem Stand vor der Pandemie im Jahr 2019.
Es geht nicht ohne Digitale Transformation
Mit Technologien wie digitalen Zwillingen und Edge Computing können Versorgungsunternehmen ihren Betrieb optimieren, Ausfallzeiten reduzieren und Anlagen besser verwalten. Digitale Zwillinge – virtuelle Nachbildungen physischer Systeme – ermöglichen es den Systembetreibern, verschiedene Szenarien zu simulieren, die Leistung zu optimieren und potenzielle Schwachstellen zu erkennen. Edge Computing sorgt für verbesserte lokale Entscheidungsfindung sowie schnellere Reaktionen auf Netzanomalien. Unterstützt durch Softwareplattformen gelten die Technologien bereits jetzt als unverzichtbare Ergänzung für die Entwicklung der Branche.
Cybersicherheit muss ein Eckpfeiler der digitalen Strategie im Versorgungssektor bleiben, da die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Werkzeugen und dezentrale Energieerzeugung das Risiko von Cyberangriffen erhöhen. Je weiter sich Energieversorger vernetzen, desto besser müssen auch ihre Cybersicherheitsvorkehrungen ausgebaut sein. Durch die Implementierung robuster Sicherheitsmaßnahmen können Unternehmen ihre Infrastruktur schützen. Obwohl ständige Wachsamkeit unerlässlich ist, sollten Ängste kein Hindernis sein, die Vorteile der digitalen Transformation zu nutzen. Die Integration von KI-gesteuerten Tools und Cloud-basierten Plattformen in den Betrieb von Energieversorgungsunternehmen wird die Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Effizienz des Netzes weiter verbessern.