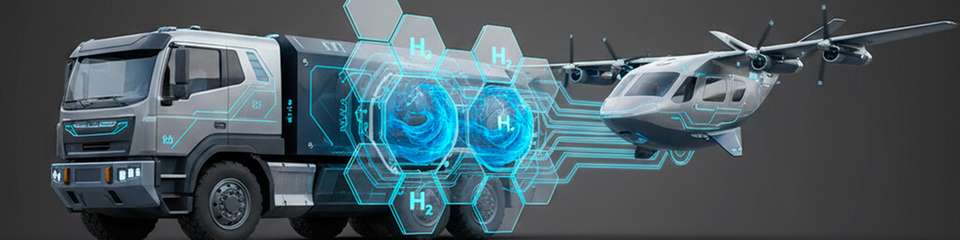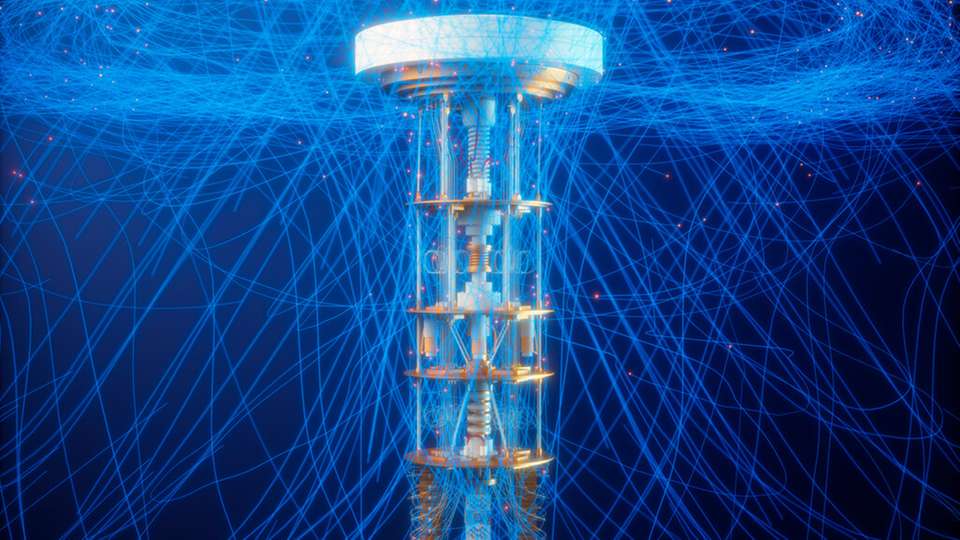Magnesiumoxid, das in der Industrie und im Gesundheitswesen als vielseitiger Werkstoff eingesetzt wird, könnte auch ein guter Kandidat für Quantentechnologien sein. Eine vom Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums (DOE) geleitete Studie hat einen Defekt in dem Mineral entdeckt, der für Quantenanwendungen nützlich sein könnte.
Forscher untersuchen mögliche Bausteine, sogenannte Qubits, für Systeme, die Quanteneigenschaften nutzen könnten. Diese Systeme könnten in verschiedenen Geräten eingesetzt werden, die klassische Supercomputer übertreffen, unhackbare Netzwerke bilden oder selbst schwächste Signale erkennen könnten. Um das Potenzial von Qubits für Anwendungen wie Quantencomputing, Sensorik und Kommunikation auszuschöpfen, ist ein Verständnis der Materialien auf atomarer Ebene erforderlich.
Materialien für Qubits auswählen
Qubits können unter Verwendung vieler verschiedener Materialien und Strategien hergestellt werden. Eine solche Strategie ist der „Spin-Defekt“, bei dem eine Unregelmäßigkeit in der atomaren Struktur eines Materials Informationen speichern kann. Eine Unregelmäßigkeit kann in Form von fehlenden Atomen oder „fremden“ Atomen (auch Dotierstoffe genannt) vorliegen, die dem Material hinzugefügt werden.
Siliziumkarbid und Diamant sind neben anderen Materialien gut untersuchte Spin-Defekte. Beispielsweise ist das „Stickstoff-Leerstellen-Zentrum“ in Diamant ein prototypischer Spin-Defekt, bei dem ein Stickstoffatom (das Dotierungsmittel) neben einem fehlenden Kohlenstoffatom (der Leerstelle) liegt. Obwohl Siliziumkarbid und Diamant vielversprechend sind, haben sie einige Nachteile, die die Erforschung anderer Feststoffe als Wirte für Spin-Defekte rechtfertigen. Darüber hinaus könnte die Identifizierung von Spindefekten in neuen Wirtsmaterialien das Potenzial von Quantenanwendungen erweitern.
Magnesiumoxid betritt die Quantenarena
Neben einer Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Bauwesen, Gesundheitswesen, Abwasserbehandlung und anderen Sektoren wird Magnesiumoxid häufig in der Mikroelektronik eingesetzt. Mikroelektronische Geräte versorgen unzählige Systeme wie Smartphones und Sensoren mit Strom. In dieser Forschung versuchten Wissenschaftler, die Verwendung von Magnesiumoxid noch weiter auszubauen und sein Potenzial für Quantentechnologien zu untersuchen.
Bei der Erforschung von Qubit-Materialien kommt es vor allem auf die Kohärenz an: die Zeitspanne, in der ein Qubit seinen Zustand beibehalten kann, bevor es durch seine Umgebung gestört wird. Eine Studie aus dem Jahr 2022 prognostizierte, dass Magnesiumoxid lange Kohärenzzeiten für Spin-Defekte aufweisen könnte. Zu den Forschern dieser Studie gehörte Giulia Galli, leitende Wissenschaftlerin am Argonne National Laboratory und Liew-Family-Professor für Elektronenstruktur und Simulation an der Pritzker School of Molecular Engineering und der Fakultät für Chemie der University of Chicago.
In der neuen Studie machten sich die Materialwissenschaftlerin und Maria-Goeppert-Mayer-Fellow Vrindaa Somjit und Galli zusammen mit Kollegen der University of Chicago und der Linköping University in Schweden daran, das in der früheren Forschung aufgezeigte Potenzial zu untersuchen. „Jedes Material kann unzählige mögliche Defekte aufweisen“, sagte Somjit. „Obwohl die Studie von 2022 darauf hinwies, dass Magnesiumoxid eine potenziell lange Spin-Qubit-Kohärenzzeit hat, wussten wir nicht, welcher bestimmte Defekt vielversprechend sein würde.“
Von Tausenden von Defekten zu einem vielversprechenden Qubit
Mithilfe eines Hochdurchsatz-Screenings, bei dem Kandidaten durch automatisierte Filter auf einem Hochleistungscomputer schnell bewertet werden, hat das Team fast 3.000 Defekte in Magnesiumoxid gesichtet. Unter den gesuchten Eigenschaften sind zwei für Qubits von besonderem Interesse: die Wechselwirkung des Defekts mit Licht und die Spineigenschaften des Defekts. Durch die Identifizierung dieser Eigenschaften konnte die Anzahl der potenziellen Spinfehler auf 40 reduziert werden. Von diesen suchte das Team weiter nach Fehlern, die am ehesten experimentell synthetisiert werden konnten. Der Gewinner: ein Stickstoff-Leerstellen-Zentrum, ähnlich dem in Diamanten untersuchten. Das Stickstoff-Leerstellen-Zentrum in Magnesiumoxid besteht aus einem Stickstoffatom (dem Dotierstoff) neben einem fehlenden Magnesiumatom (der Leerstelle).
Diese erste Screening-Runde ergab ein ungenaues Bild der Eigenschaften des Spin-Defekt-Kandidaten in Magnesiumoxid. Um eine genauere Charakterisierung zu erhalten, führten Somjit und sein Team Berechnungen mit Hilfe von hochentwickelten Theorien und Open-Source-Codes durch, die vom Midwest Integrated Center for Computational Materials, einem Zentrum für computergestützte Materialwissenschaften mit Sitz in Argonne, entwickelt wurden, das vom DOE finanziert und von Galli geleitet wird.
Das Team führte seine Berechnungen auf Hochleistungscomputern in zwei Einrichtungen des DOE Office of Science durch, der Argonne Leadership Computing Facility (insbesondere dem Supercomputer Polaris) und dem National Energy Research Scientific Computing Center (NERSC) am Lawrence Berkeley National Laboratory.
Weitere Schritte im Labor
Mit diesen Berechnungen konnte das Team die optischen Eigenschaften des Defekts charakterisieren und verstehen, wie er mit den umgebenden Magnesium- und Sauerstoffatomen interagiert. Die durch Theorie und Berechnung vorhergesagten Eigenschaften werden bei der zukünftigen experimentellen Charakterisierung dieses Defekts hilfreich sein. „Mithilfe unserer integrierten Software, die präzise Methoden zur Berechnung der elektronischen Struktur effizient umsetzt, konnten wir die Eigenschaften eines neuen Spin-Qubits in einem neuen Oxid-Wirtsmaterial aufklären. Wir freuen uns darauf, dies auf andere Spin-Defekte und Wirte auszuweiten“, sagte Galli.
Nachdem die Berechnungen der Studie die Idee bestätigt haben, dass ein Stickstoff-Vakanz-Zentrum in Magnesiumoxid als Qubit zur Speicherung von Informationen verwendet werden könnte, besteht der nächste Schritt darin, mit Experimentalwissenschaftlern zusammenzuarbeiten, um ein solches Qubit im Labor zu synthetisieren, sagte Somjit. Die Forschung hat auch das Potenzial aufgezeigt, dasselbe Berechnungsprotokoll zu verwenden, um andere vielversprechende Defekte in Magnesiumoxid und anderen Materialien zu untersuchen.
„Wir haben in dieser Studie verschiedene elektronische und optische Eigenschaften berechnet, die uns tiefe Einblicke in den Magnesiumoxid-Wirt und das Stickstoff-Vakanz-Qubit verschafft haben. Aber das ist natürlich nur der Anfang“, sagte Somjit. „Es gibt noch viele weitere Eigenschaften, die berechnet werden können und die sich für die Entwicklung besserer Qubits in Oxidmaterialien eignen würden.“