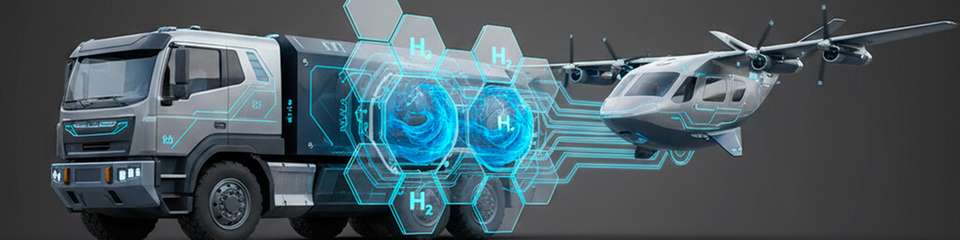Kohlendioxid (CO2) und Stickoxide (NOx) zählen zu den bedeutendsten anthropogenen Luftschadstoffen – mit Folgen für Klima, Gesundheit und Luftqualität. Satellitenmessungen gelten als zentrale Methode zur unabhängigen Emissionsüberwachung. Sie stoßen aber bisher an Grenzen: Viele Sensoren verfügen über eine zu grobe räumliche Auflösung, um punktuelle Emissionsquellen wie Kraftwerke zuverlässig zu erfassen. Zusätzlich wirken sich atmosphärische Prozesse, etwa Wolken oder die chemische Weiterreaktion von Stickoxiden störend auf die Auswertung aus. Im Falle von CO2 kommt erschwerend hinzu, dass die hohen Hintergrundwerte die vergleichsweise schwachen Emissionssignale oft überdecken.
Da NO2 und CO2 gemeinsam emittiert werden, werden NO2-Messungen häufig auf Basis bekannter Emissionsverhältnisse zur Abschätzung von CO2-Emissionen genutzt. Bislang fehlt jedoch ein Instrument, das beide Gase gleichzeitig mit hoher räumlicher Auflösung erfassen kann. Die nun vorgestellte Methode schließt diese Lücke: Erstmals lassen sich beide Gase gleichzeitig und mit hoher Auflösung direkt über den Quellen messen – und ihr Verhältnis präzise bestimmen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für eine unabhängige und transparente satellitengestützte Emissionsüberwachung.
EnMAP: Hochauflösende Perspektiven
Atmosphärische Spurengase wie CO2 und NO2 hinterlassen im Sonnenlicht charakteristische Absorptionsmuster, die mit Spektrom nachgewiesen werden können. Für satellitengestützte Messungen kommen üblicherweise Instrumente mit sehr hoher spektraler Auflösung zum Einsatz. Sie können die feinen Absorptionsstrukturen der Gase im reflektierten Sonnenlicht analysieren, erreichen dabei jedoch meist nur eine räumliche Auflösung von 3 bis 5 km.
Der deutsche Erdbeobachtungssatellit EnMAP wurde hingegen ursprünglich für die Fernerkundung von Landoberflächen konzipiert. Er liefert Aufnahmen mit außergewöhnlich hoher räumlicher Detailgenauigkeit von 30 x 30 m, verfügt jedoch nur über eine vergleichsweise geringe spektrale Auflösung.
Die neue Studie zeigt nun, dass – entgegen bisheriger Annahmen – selbst mit einem eigentlich nicht für atmosphärische Messungen entwickelten Instrument wie dem Satelliten EnMAP verlässliche Messungen von Spurengasen möglich sind. „Es ist uns gelungen, mithilfe der EnMAP-Daten die Verteilung von CO2 und NO2 in Abgasfahnen einzelner Kraftwerke zu bestimmen, etwa über Anlagen in Saudi-Arabien sowie in der südafrikanischen Highveld-Region, einem der weltweit größten Emissions-Hotspots“, erklärt Christian Borger, Erstautor der Studie und bis vor kurzem Postdoc in der Satellitenfernerkundungsgruppe am Max-Planck-Institut für Chemie. Er arbeitet nun beim Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (ECMWF) in Bonn.
Von der Messung zur Anwendung
Somit können mithilfe des EnMAP-Satelliten CO2- und NOx-Emissionen einzelner Kraftwerke gleichzeitig und hochaufgelöst bestimmt werden. Darüber hinaus lassen sich daraus NOx/CO2-Verhältnisse ableiten, die Rückschlüsse auf Technologie, Effizienz und Betriebsweise der Anlagen ermöglichen. Perspektivisch könnten solche Verhältnisse genutzt werden, um CO2-Emissionen allein auf Basis von NO2-Daten abzuschätzen.
Zudem ermöglichen die Daten neue Einblicke in die chemische Umwandlung von NO zu NO2 innerhalb von Abgasfahnen. Dieser zentrale Prozess in der atmosphärischen Chemie konnte bislang nur durch aufwendige Flugzeugmessungen erfasst werden. Die Nutzung von Satellitendaten hat große Vorteile, da sie eine weltweite, einheitliche und vergleichbare Erfassung industrieller Schadstoffemissionen ermöglicht.
Impulse für neue Missionen
„Unsere Studie zeigt, wie Satelliten mit hoher räumlicher Auflösung künftig zur gezielten Überwachung industrieller Emissionen beitragen können – auch ergänzend zu großflächigen Missionen wie dem europäischen Satelliten CO2M“, resümiert Gruppenleiter Thomas Wagner. Der Umweltsatellit EnMAP eröffne neue Perspektiven für ein globales, satellitengestütztes Monitoringsystem für Luftschadstoffe und Treibhausgase.