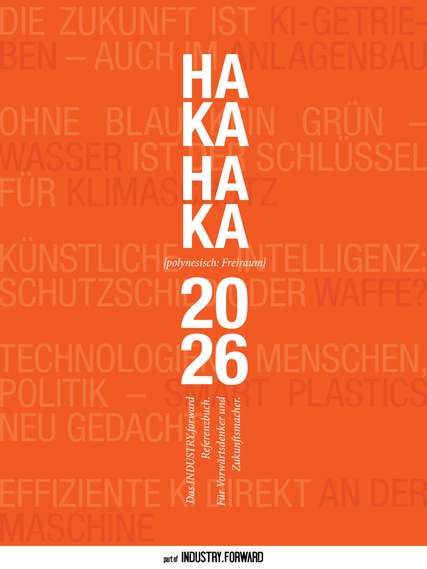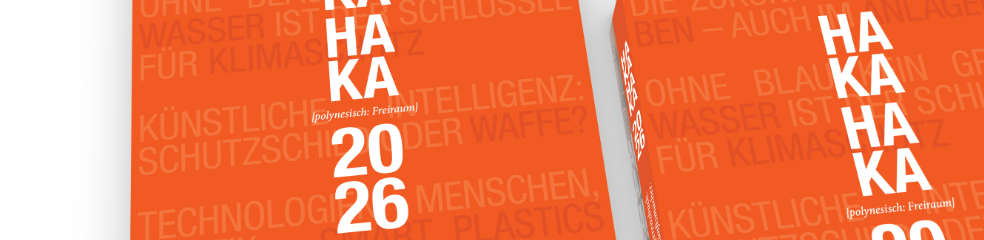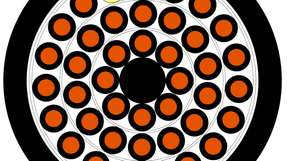Um die ambitionierten Reduktionsziele zu erreichen, muss die Industrie ihre Emissionen künftig mindestens dreimal so schnell senken wie im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Dazu müssen alle Emissionsquellen, von den direkten Emissionen über die Zulieferkette bis hin zu den technischen Komponenten berücksichtigt und reduziert werden. Dies bedarf gezielter Maßnahmen in allen relevanten Scopes – also entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Insbesondere durch die Optimierung von Antriebs- und Kühltechnologien sowie durch innovatives Condition Monitoring lassen sich erhebliche Energieeinsparungen und Emissionsminderungen erzielen, die einen entscheidenden Beitrag zur Klimaneutralität leisten können.
Ein erheblicher Teil der Emissionen entsteht nicht nur im Betrieb (Scope 1 und 2), sondern auch in der vorgelagerten Lieferkette (Scope 3). Gerade in Branchen wie dem Maschinenbau und der Prozessindustrie sind die Emissionen aus Vorprodukten und Investitionsgütern besonders hoch. Dennoch liegt der Fokus in vielen Unternehmen bislang eher auf dem Energieverbrauch und der Beschaffung von Rohstoffen, während technische Komponenten wie Automatisierungslösungen oder Antriebssysteme seltener betrachtet werden – obwohl hier erhebliche Einsparpotenziale bestehen.
Ein praktisches Beispiel für CO2-Reduktion und Energieeffizienz ist die Optimierung der Kühlung von Schaltschränken. Durch die Kombination von passiven und aktiven Kühltechnologien können bis zu 80 Prozent des Energieverbrauchs eingespart werden – bei einer sehr kurzen Amortisationszeit von nur zwei Jahren. Ein zertifiziertes Vergleichstool des ZVEI zeigt, dass die Lebenszykluskosten bei einem Betrachtungszeitraum von zehn Jahren nahezu halbiert werden können, was sowohl ökonomische als auch ökologische Vorteile bietet.
Darüber hinaus eröffnet Condition Monitoring bei pneumatischen Antrieben neue Möglichkeiten, Effizienzpotenziale in bestehenden Anlagen zu heben. Die Antriebsüberwachung mittels Druck- und Zeitverlaufsmessung ermöglicht nicht nur die Früherkennung von Fehlern, sondern auch die gezielte Optimierung von Sicherheitsreserven – zum Beispiel durch die Reduzierung überdimensionierter Drehmomente. Energieverbrauch und CO2-Fußabdruck können so nachhaltig reduziert werden.
Auf lange Sicht wird auch der Technologievergleich an Bedeutung gewinnen. Die differenzierte Betrachtung elektrischer und pneumatischer Antriebssysteme zeigt: Nicht eine dieser Technologien ist generell besser. Vielmehr wird die Entscheidung künftig stärker vom CO2-Footprint über den gesamten Lebenszyklus – von der Herstellung des Antriebs bis zum Ende des Betriebs – abhängen. Eine belastbare Bewertung setzt allerdings voraus, dass relevante Daten durchgängig erfasst, analysiert und sinnvoll genutzt werden.
Auch in bestehenden Anlagen gibt es erhebliche Potenziale zur Emissionsreduktion. Entscheidend ist, dass Monitoring, Effizienztechnologien und die Bewertung alternativer Lösungen konsequent zusammengeführt werden. Nur so kann die Industrie ihren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten – wirtschaftlich sinnvoll und technologisch fundiert.