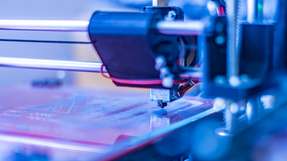Wie bei der KI-Debatte lösen auch Automatisierung und Smart Manufacturing immer wieder Unbehagen aus, beispielsweise in Form der Befürchtung, Maschinen könnten den Menschen überflüssig machen. Doch genau hier markiert Industrie 5.0 einen grundlegenden Paradigmenwechsel: Während bei Industrie 4.0 der Fokus auf technologischer Beschleunigung lag, rückt die nächste industrielle Entwicklungsstufe den Menschen wieder stärker in den Mittelpunkt – nicht als Gegenspieler, sondern als Partner einer intelligenten, kollaborativen Maschinenwelt.
Die Europäische Kommission beschreibt Industrie 5.0 als ganzheitlicher und zukunftsorientierter: Sie beruht auf den drei Leitprinzipien Nachhaltigkeit, Resilienz und Menschzentrierung. Dies ist eine Ausrichtung, die sich nahtlos mit den Zielen des Smart Manufacturing verbindet und damit die Grundlage für eine neue industrielle Wirklichkeit schafft, in der Effizienz, Innovation und Verantwortung Hand in Hand gehen.
Intelligente Steuerung für smarte Fabriken
Das CESMII (The Smart Manufacturing Institute) definiert Smart Manufacturing als das integrierte Zusammenspiel digitaler und physischer Abläufe. Dabei analysieren vernetzte, datengetriebene Systeme Ereignisse in Echtzeit und reagieren autonom. Sensoren überwachen den Betrieb kontinuierlich, erfassen Felddaten, während automatisierte Analysemodelle Routineprozesse übernehmen und bei Auffälligkeiten Handlungsvorschläge unterbreiten. So entstehen intelligente, digitale oder autonome Fabriken.
Ein zentrales Element dabei ist die multiphysikalische Simulation, die die Prognosefähigkeit liefert, um Sensordaten zielgerichtet auszuwerten und Entscheidungsprozesse zu verbessern. Zusammen mit KI und Machine Learning ermöglicht sie Schlüsseltechnologien wie digitale Zwillinge, additive Fertigung oder fortgeschrittene Automatisierung. In industrielle Abläufe integriert, wird die Simulation so zum Treiber fortlaufender Optimierung und steht damit im Zentrum des Smart Manufacturing.
Flexible Systeme mit spürbarem Nutzen
Laut McKinsey & Company könnten durch den breiten Einsatz von Simulationen, KI, Machine Learning und Advanced Analytics Maschinenstillstände um 30 bis 50 Prozent reduziert werden. Dabei wird die Produktivität um 10 bis 30 Prozent gesteigert und eine Prognosegenauigkeit von bis zu 85 Prozent erreicht.
Dies wird durch vernetzte Systeme, IIoT-Sensorik (Industrial Internet of Things), Cloud-Technologien und Analyseplattformen ermöglicht – oft in Kombination mit Automatisierung und Robotik. Dieses technologische Fundament erschließt große Datenmengen, beschleunigt Produktionsprozesse und verbessert die Performance.
Gleichzeitig unterscheidet sich jede Fabrik in ihrer digitalen Reife. Einige setzen auf KI oder Cloud Computing, andere auf eingebettete Systeme oder spezifische Analysetools. Auch die Netzwerkinfrastruktur variiert: Während kleinere Werke mit WLAN arbeiten, nutzen größere Industrieanlagen private 5G-Netze, um maximale Bandbreite, Reaktionsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Leistungsfähigkeit mit Weitblick gestalten
So unterschiedlich intelligente Fabriken auch sind – sie alle nutzen Innovation, um Effizienz entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu steigern: von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Wartung.
Ein zentrales Element ist das New Product Introduction (NPI) – ein Prozess, der im Gegensatz zum klassischen Designansatz bereits frühzeitig Aspekte wie Fertigbarkeit, Skalierbarkeit, Kosten und Time-to-Market einbezieht. Produktionsabteilungen werden bewusst früh involviert – ein Paradebeispiel für den systemischen Charakter von Smart Manufacturing und die Werte der Industrie 5.0: Vernetzung, Vorausdenken und Effizienz.
Technologien für neue Produktionsmodelle
Mehrere Technologien prägen diese neue industrielle Realität.
Advanced Analytics und KI beschleunigen Datenflüsse und Entscheidungsprozesse.
Industrielle Automatisierung ersetzt oder ergänzt manuelle Aufgaben wie Palettieren oder additive Fertigungsschritte.
Digitalisierte Workflows, unterstützt durch Simulationssoftware, ermöglichen automatisierte und optimierte interne Abläufe.
Autonome Systeme, gesteuert über digitale Zwillinge und KI, verbessern Effizienz und Sicherheit in Echtzeit.
Virtuelle Tests, vorausschauende Wartung und optimiertes Engineering senken Ausschuss, Ressourcenverbrauch und Entwicklungszyklen – mit dreifachem Gewinn: ökonomisch, operativ und ökologisch.
Simulation als Basis für industrielle Wettbewerbsfähigkeit
In einem zunehmend volatilen Umfeld etabliert sich Simulation als strategischer Leistungsfaktor. Nach dem „Shift-Left“-Prinzip kann sie bereits in frühen Designphasen integriert werden – um technische Entscheidungen zu optimieren, Fehlerquellen zu antizipieren, Entwicklungskosten zu senken und Produkte schneller zur Marktreife zu bringen.
Doch der Nutzen endet nicht beim Design: In Verbindung mit KI, Sensoren, digitalen Zwillingen und ML wird Simulation zum Echtzeitwerkzeug für vorausschauende Wartung, maximale Anlagenverfügbarkeit und ressourcenschonende Prozessführung.
Sie schafft die Grundlage für den Erfolg neuer Technologien wie additive Fertigung, verbessert Erfolgsquoten, reduziert Iterationen, senkt Abfall und erhöht die Resilienz der Lieferketten – etwa durch lokalere, bedarfsorientierte Produktion.
Weltweit verändert die durch Simulation gestützte digitale Produktentwicklung bereits die Wettbewerbsstandards ganzer Branchen. Laut Mordor Intelligence könnte der Markt für Smart Factories bis 2030 ein Volumen von 619 Milliarden US-Dollar erreichen – ein unmissverständliches Signal.
In dieser neuen Realität reicht es nicht mehr, Entwicklungen zu folgen – Industrieunternehmen müssen sie vorantreiben. Simulation als Kern ihrer Strategie zu etablieren, heißt: schneller innovieren, intelligenter produzieren und nachhaltig wettbewerbsfähig bleiben.