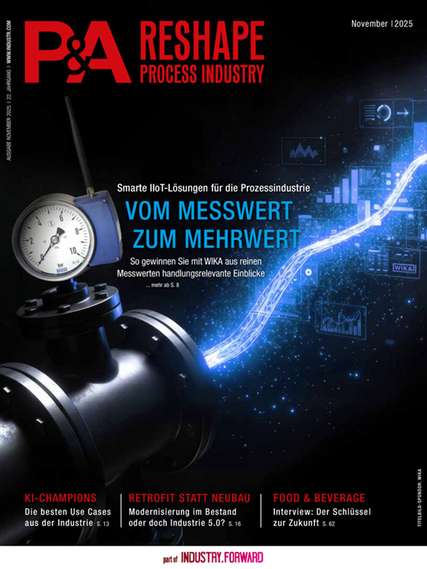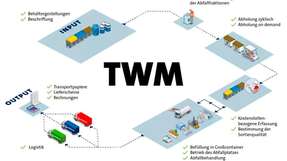Wäre es mit dem Zerkleinern und Wiederaufbereiten von genutzten Packmitteln getan, hinge erfolgreiches Recycling lediglich von funktionierenden Anlagen bei den jeweiligen Unternehmen ab. Dass es so einfach nicht sein kann, wird beim Blick auf die unterschiedlichen Materialien und Verpackungsarten deutlich: Längst nicht alle Packmittel eignen sich dazu, wieder in den Wertstoffkreislauf zurückzukehren – etwa, weil sie mitunter nur schwer oder gar nicht wiederverwertbare Materialfraktionen enthalten. Diese gehen wiederum auf die zahlreichen Anforderungen zurück, die eine Verpackung erfüllen muss. So verleiht PET ihr Transparenz, Festigkeit und Formstabilität, während flexibles PP dichtend wirkt. Um dabei effizient vorzugehen, müssen Recycler wissen, mit welchen Materialien sie es zu tun haben – und arbeiten sich dazu mit Detektionstechnik durch abertausende t Wertstoffe aus dem gelben Sack. Dies setzt wiederum eine effektive Wertstoffsammlung voraus, die EU-weit alles andere als einheitlich gehandhabt wird.
So komplex das Unterfangen Recycling auch ist, so zahlreich fallen die Stellschrauben für effizientere Prozesse aus. Dabei stehen längst nicht nur die Recycler in der Pflicht. Vielmehr kommen entlang des Lebenszyklus einer Verpackung – von ihrem Rohstoff bis zum fertig gestalteten und befüllten Produkt – mehrere Akteure ins Spiel, die einem wirksamen wie ganzheitlichen Recycling Vorschub leisten können – und es laut Michael Graf auch sollen. Der Leiter des Packaging Competence Center, einem Kompetenzzentrum von Gerhard Schubert für regulatorische und technische Fragestellungen bei nachhaltigen Konsumgüterverpackungen, sieht sämtliche Beteiligten in der Pflicht, das Recycling möglichst gemeinschaftlich anzugehen. Anders, so der Experte, ließen sich die hehren Ziele der mittlerweile rechtsverbindlichen EU-Verordnung nicht einhalten: „Eine vollständige Recyclingfähigkeit aller Verpackungen auf dem EU-Binnenmarkt bis 2030 setzt ein enges Zeitfenster, das schnelles Handeln erfordert. Je früher ein Recycler ein Produkt in den Strom bringen kann, umso effizienter kann er recyceln.“
Das setzt eine nahtlose Kommunikation voraus, die künftig direkt am Produkt ansetzt. Über einen Digitalen Produktpass (DPP), den die EU schrittweise für unterschiedliche Konsumgüter einführen möchte, sollen nicht nur Verbraucher, sondern auch Recycler, Hersteller und Behörden Zugang zu verlässlichen Daten über Zusammensetzung, Herkunft und Verarbeitungsfähigkeit von Materialien erhalten. Ab 2027 wird dieses Schlüsselelement der EU-Kreislauftransparenz für erste Produktgruppen verpflichtend. Im Fall des Recyclers könnte diese Vorabinformation die manuelle Sortierung von Kunststoff dank verbesserter Materialerkennung vereinfachen und damit beschleunigen.
Was in der Theorie pragmatisch klingt, setzt praktisch die Kooperation zahlreicher Wertstrom-Akteure voraus. Die Codes, in der Regel QR Codes, müssen auf die Packmittel – und zwar so, dass sie sich einwandfrei auslesen lassen. Das ruft Material-, Drucksystem- und Verpackungsmaschinenhersteller auf den Plan, da Packstoffe und Drucktechnologien in der Verpackungsanlage aufeinandertreffen. „Wir benötigen nicht nur Drucksysteme, die lesbare, intakte Codes auf unterschiedliche Packmittel wie Mono- oder Papierfolien drucken können, sondern sich auch in die Verpackungsmaschinen integrieren lassen“, erläutert Graf die Anforderungen, die ein Produktpass – so wie jede andere Form der codebasierten Kommunikation auf Verpackungen – mit sich bringt.
Je mehr Informationen ein Code umfasst, umso mehr Fläche nimmt er beispielsweise auf der Verpackung ein – und erfordert unter Umständen ein angepasstes Verpackungsdesign. Auch die Wahl der Drucktechnologie ist alles andere als trivial: So gibt es Verfahren, die schonender arbeiten als andere – eine wichtige Voraussetzung in der Lebensmittelindustrie, wo jede Beeinträchtigung der Verpackung die Qualität der Produkte kompromittieren kann. UV-Laser etwa arbeiten photochemisch und nicht thermisch, wodurch sie Folien nicht verbrennen oder verkohlen. Wo dennoch Tinte zum Einsatz kommt, müssen Hersteller sicherstellen, dass keine toxischen Rückstände die verpackte Ware kontaminieren. „Welche Systeme sich eignen und welche nicht, ermitteln die jeweiligen Akteure idealerweise im Verbund. Angesichts der hohen Anforderungen der EU-Verordnung haben wir keine andere Wahl. Die PPWR schweißt uns zusammen“, betont Graf.
Verpackungsmaschinenherstellern kommt indes eine weitere wichtige Rolle zu. Hinsichtlich der Materialien und dem von PPWR und EU-Ökodesign-Verordnung (ESPR) vorgeschriebenen Design for Recycling – also einer auf Zirkularität ausgerichteten Gestaltung mit möglichst wenig Materialmix – verfügen sie über ein breites Wissen, das sie direkt an die Konsumgüterhersteller weitergeben können. Längst nicht jeder Hersteller verfolgt konsequent das Prinzip des Design for Recycling, das die Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) seit Juli 2024 regelt. Langfristig, so der Ansatz, sollen auf dem EU-Markt angebotene Produkte durch verbesserte Kreislauffähigkeit, Energieeffizienz, Recyclingfähigkeit und Langlebigkeit deutlich nachhaltiger werden.
Testen und Brücken bauen
Verpackungsmaschinenhersteller wie Schubert unterstützen deshalb bei der Auswahl geeigneter Materialien und sorgen dafür, dass Verpackungen nicht nur funktional, sondern auch recyclingfähig sind. Dazu bieten Maschinenhersteller die Möglichkeit, Tests auf eigenen Anlagen durchzuführen, um die Maschinengängigkeit recyclingfähiger Materialien praktisch zu überprüfen. „Idealerweise bilden sie auch eine Brücke zwischen Konsumgüterherstellern und Recyclingunternehmen, um frühzeitig sicherzustellen, dass eine bestimmte Verpackung tatsächlich im Kreislauf bleiben kann.“
Wie das praktisch aussieht, zeigt sich am Beispiel der bekannten Kaffeekapsel: Um den Materialbedarf bei den kleinen Verpackungen aus Kunststoff oder Aluminium zu reduzieren, pressen einige Hersteller den Kaffee inzwischen zu formstabilen Kugeln, Pods oder Tabs. Diese haben von sich aus keine Barriere. Das wirkt sich auf die restliche Verpackung aus. Welche technischen Anpassungen für die Hochbarriere in der Verpackung erforderlich sind – und welche recyclingfähigen Materialien sich für einen solchen Ansatz eignen – entwickeln Kaffee-, Folien- und Maschinenproduzenten zusammen. Gemeinsam ermitteln sie, wie sich neue Verpackungskonzepte auf Anlagen realisieren lassen – von der Materialwahl für das Tray bis zur Siegeltechnologie für die Barrierefolie. „Die Deckelfolie muss ein Hersteller in der vorgegebenen Produktionsgeschwindigkeit siegeln können, und auch die Fasern des Trays und die Folie müssen harmonieren“, so Graf.
Wichtig ist dabei auch, die Markenverantwortlichen mit ins Boot zu holen. „Neue Materialien können Haptik, Optik und damit die Identität von Verpackung und Marke verändern“, hebt Michael Graf hervor. „Damit das nachhaltige Verpackungsdesign am Ende sowohl den ökologischen Anforderungen als auch den Markenansprüchen gerecht wird, müssen Technik, Zertifizierung und Markenstrategie ineinandergreifen.“
Nachholbedarf bei Infrastruktur
Bei der ganzen Produkt- und Verpackungsentwicklung darf indes eines nicht fehlen, wenn es auch nicht direkt in der Hand der Maschinen-, Material- und Konsumgüterhersteller liegt. „Für eine wahrhaft zirkuläre Wertstoffnutzung braucht es eine flächendeckende Sammel-, Sortier- und Recycling-Infrastruktur“, hebt Michael Graf hervor. Dabei besteht Nachholbedarf: Deutschland zeigt mit hohen Recyclingquoten 2023 – 38 Prozent der Gesamt-Kunststoffabfälle und über 90 Prozent bei Gesamtverpackungen – zwar seine Stärke.
Gleichzeitig besteht Handlungsbedarf: Von den 5,6 Millionen t Plastikmüll, die in Deutschland anfallen, werden derzeit nur etwa 3,2 Millionen t für das Recycling gesammelt. Prognosen gehen davon aus, dass die Nachfrage nach Rezyklaten bis 2030 um rund 30 Prozent höher sein wird als das verfügbare Angebot. Vor allem bei den von der PPWR vorgeschriebenen Post-Consumer-Rezyklaten (PCR), also Rezyklate aus bereits verwendetem Kunststoff, dürfte es mangels geeigneter Recyclinginfrastrukturen eng werden, die ambitionierten Vorgaben einzuhalten. 30 Prozent PCR in PET-Flaschen, 35 Prozent in Non-Food-Kunststoffen lauten die Vorgaben aus Brüssel.
„Dies ist ein deutliches Signal, dass das System weiterentwickelt werden muss, um Kreislaufwirtschaft in großem Maßstab zu ermöglichen“, so Graf. Chancen sieht er in einer noch engeren Kooperation, etwa zwischen Recycler und Materialhersteller, um weitere wichtige Impulse für effizienteres Recycling zu geben – und in einer gezielten Aufklärung der Verbraucher. Schließlich seien Rücknahmestellen und Pfandsysteme nur zwei Herausforderungen von vielen: „Längst nicht alle Verpackungen werden korrekt entsorgt, wodurch wir gerade beim Plastik viel Recyclingpotenzial verspielen. Maschinenbauer und Materialhersteller machen viel, aber der Konsument muss mitziehen. Nachhaltigkeit betrifft die gesamte Lieferkette.“ Es reiche demnach nicht nur, Gesetze zu haben, vielmehr müssten sämtliche Akteure diese konsequent umsetzen – nicht pro forma, sondern aus aufrichtigem Interesse an einer zirkulären Zukunft.