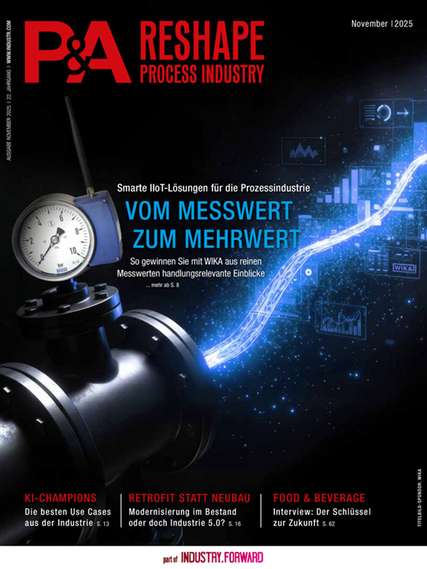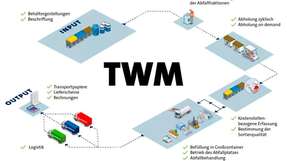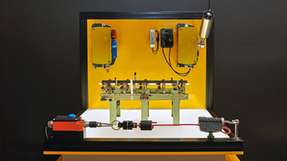Steigende Energiekosten machen vielen Unternehmen zu schaffen. Zum Arbeitspreis, den Netzentgelten und weiteren Preiskomponenten für fossile Energieträger kommt der CO2-Preis, der in den letzten Jahren kontinuierlich angehoben wurde: Derzeit kostet die Tonne CO2 nach BEHG 55 Euro und nach EU-ETS rund 75 Euro. Dadurch beträgt der CO2-Kostenanteil für eine Megawattstunde Erdgas 11 respektive 14 Euro. Durch die Verknappung der verfügbaren Zertifikate in der EU ist mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen. MVV geht von einem mittelfristigen CO2-Preis von 100 Euro pro Tonne aus. Gleichzeitig spielt die Klimabilanz für Unternehmen eine immer größere Rolle. Es gibt also gute Gründe, um klimafreundlichere Möglichkeiten zur Dampferzeugung zu prüfen.
Dampferzeugung mit Elektrokessel
Elektrokessel erzeugen Dampf mit Strom. Stammt er aus erneuerbaren Quellen, ist diese Art der Dampferzeugung CO2-neutral. Elektrokessel reagieren schnell auf Laständerungen und eignen sich deshalb gut für Prozesse mit schwankendem Dampfbedarf. Wirtschaftlich sind Elektrokessel sinnvoll, wenn sie gezielt zu Zeiten eingesetzt werden, in denen die Strompreise auf dem Spotmarkt niedrig sind. Das ist beispielsweise rund um die Mittagszeit der Fall, wenn überschüssiger Solarstrom die Netze „flutet“. Der optimierte Betrieb des Elektrokessels lässt sich realisieren, wenn dieser automatisiert über Preisimpulse gesteuert wird, die durch eine Schnittstelle zum Spotmarkt beziehungsweise zum Stromhandel ausgelöst werden.
Dampf aus Abwärme
Viele Unternehmen müssen nach dem Energieeffizienzgesetz Abwärme vermeiden und wiederverwenden. Die Dampferzeugung aus Abwärme kann auch eine wirtschaftliche Methode der Abwärmenutzung sein. Projektentwickler identifizieren hierfür zunächst die vorhandenen Abwärmequellen und bewerten deren Potenzial. Entscheidend sind Temperatur, Wärmemenge und Lastgang sowie die Zugänglichkeit der Wärmequellen. Die Abwärme wird in der Regel auf ein Sekundärmedium übertragen, beispielsweise Wasser. Für Hochtemperaturanwendungen eignet sich Thermalöl als Sekundärmedium. Hohe Abwärmetemperaturen (200 bis 500°C) können direkt für die Eigenstromerzeugung (Heat-to-Power) oder die Beheizung eines Wärmenetzes genutzt werden. Abwärme bei mittleren Temperaturen (zum Beispiel 30 bis 50°C) muss per Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gehoben werden, um Dampf zu gewinnen.
Im Vergleich zu Elektrokesseln erfordern Wärmepumpen höhere spezifische Investitionen (Euro/kWth), arbeiten jedoch deutlich effizienter. Sie finden zunehmend Anwendung in der industriellen Abwärmenutzung: Abwärme bei 30 bis 50°C lässt sich bereits über mehrstufige Wärmepumpen auf 130°C anheben und direkt für die Sattdampferzeugung nutzen. Für die Wirtschaftlichkeitsbewertung ist der Coefficient of Performance (COP) eine aussagekräftige Kennzahl. Hochtemperaturwärmepumpen arbeiten bei COP-Werten zwischen 2 und 3, nutzen die elektrische Energie also um den Faktor 2 bis 3 effektiver als Elektrokessel.
Sind höhere Druckniveaus erforderlich, kann der Dampf mittels Dampfkompressor auf ein beliebiges Druck- und Temperaturniveau hochverdichtet werden. Diese sogenannten MVR (Mechanical Vapor Recompression) arbeiten einstufig oder mehrstufig und werden als Kolbenkompressor, Scroll-Verdichter oder Turbomaschine ausgeführt. MVR haben üblicherweise bessere COP-Werte als Hochtemperaturwärmepumpen.
Ein Beispiel aus der Papierindustrie: Die warme und feuchte Abluft aus den Trockenpartien von Papiermaschinen enthält einen hohen Anteil an latenter Wärme – also die thermische Energie im Wasserdampf, die frei wird, wenn der in der Luft enthaltene Wasserdampf durch Abkühlen der Luft kondensiert. Diese wird über Wärmetauscher auf einen Warmwasserkreis übertragen, der als Wärmequelle für die Wärmepumpe dient. Die Temperatur der Nutzenergie ist in der Papierherstellung deutlich höher als 100 °C, für die Beheizung der Trockenzylinder wird Prozessdampf bei Temperaturen zwischen 120 und 200 °C benötigt. Eine Power-to-Heat-Lösung für die Papierindustrie besteht daher aus Hochtemperatur-Wärmepumpe (HTWP) oder aus der Kombination von HTWP und Dampfkompressor.
Reststoffverwertung
Bei manchen Produktionsverfahren entstehen biogene Reststoffe, die ein hohes Energiepotenzial aufweisen und sich somit für die Dampferzeugung nutzen lassen. Alternativ können Unternehmen vergleichsweise kostengünstiges Holz aus der Landschaftspflege oder nachhaltiger Forstwirtschaft, Holzreste aus der Sägeindustrie oder Altholz nutzen. Die thermische Verwertung nachwachsender Rohstoffe gilt in der Europäischen Union als CO2-neutral und entspricht dem Gedanken der Kreislaufwirtschaft.
MVV und Olam Food Ingredients (ofi), einer der weltweit führenden Anbieter von Lebensmittel- und Getränkeinhaltsstoffen zeigen, wie das funktionieren kann: In Mannheim verarbeitet ofi Kakaobohnen zu Kakaopulver, -butter und -masse – und neuerdings auch zu Dampf. Das Unternehmen erzeugt mit den Kakaoschalen, die bei der Verarbeitung anfallen und bisher entsorgt werden mussten, 90 Prozent des benötigten Prozessdampfs. So reduziert ofi seinen Erdgasbedarf um 90 Prozent und spart rund 8.000 t CO2 pro Jahr ein.
Planung und Bau inklusive Finanzierung und Betriebsführung der Biomasse-Kesselanlage hat das Mannheimer Energieunternehmen MVV übernommen und zusammen mit ofi Pionierarbeit geleistet: Aktuell werden Kakaoschalen weltweit nur in wenigen Anlagen für die Dampferzeugung genutzt, in Deutschland ist es die erste Biomasse-Kesselanlage dieser Art.
Sie ist so aufgebaut, dass die Kakaoschalen aus einem Silo bei ofi in einen Behälter geblasen und gesammelt werden. Von hier gelangen sie in einen Feuerraum, wo sie verbrannt werden. Das aufsteigende, 800 °C heiße Rauchgas wird durch einen Kombinationskessel aus Wasserrohr- und Rauchrohrkessel geführt und erzeugt so den Dampf. Dieser wird zur Nutzung in Sterilisierungs-, Alkalisierungs- und Desodorisierungsprozessen zu ofi geleitet.
Wie bei ofi können Unternehmen aus Reststoffen zum Beispiel Sattdampf mit 1 bis 10 bar (ü) und 100 bis 184 °C für das Waschen, Heizen und Trocknen sowie Reinigungs- und Sterilisationsprozesse gewinnen, sogar überhitzter Dampf mit 10 bar (ü) und über 300 °C für Prozessdampf beziehungsweise Prozesswärme, zur Stromerzeugung und zur Wärmeauskopplung in ein Nahwärmenetz ist möglich.
Power-to-Heat-Lösungen umsetzen
Es hängt von zahlreichen Faktoren ab, ob eine dieser Methoden für das eigene Unternehmen eine nachhaltige Alternative zum Erdgas sein kann. Dies ist deshalb individuell zu prüfen. Für wirtschaftlich sinnvolle und technisch optimierte Power-to-Heat-Lösungen ist in jedem Fall energiewirtschaftliches Know-how sowie Erfahrung im Anlagenbau und in der Betriebstechnik erforderlich. Spezialisierte Energiedienstleister unterstützen Unternehmen von der Planung über den Bau und die Finanzierung bis zum Betrieb der Anlage.