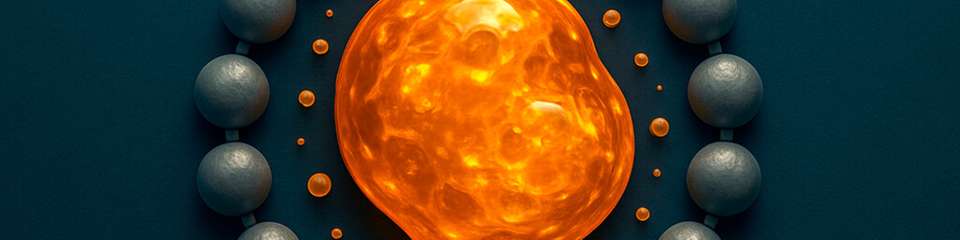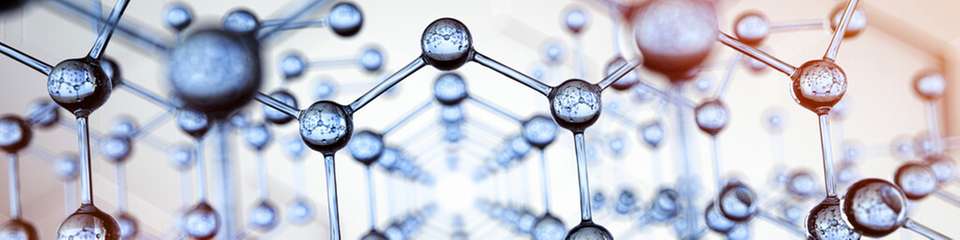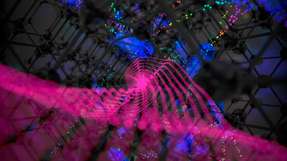Graphit ist ein wichtiger struktureller Bestandteil einiger der ältesten Kernreaktoren der Welt und vieler der heute gebauten Reaktoren der nächsten Generation. Es kondensiert und quillt jedoch unter Einwirkung von Strahlung auf – und der Mechanismus hinter diesen Veränderungen hat sich als schwer zu untersuchen erwiesen. Nun haben Forscher des MIT und ihre Kooperationspartner einen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften von Graphit und dem Verhalten des Materials unter Strahlungseinwirkung entdeckt. Die Ergebnisse könnten zu genaueren und weniger zerstörerischen Methoden zur Vorhersage der Lebensdauer von Graphitmaterialien führen, die in Reaktoren weltweit verwendet werden.
„Wir haben einige grundlegende wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, um zu verstehen, was zum Aufquellen und schließlich zum Versagen von Graphitstrukturen führt“, sagt Boris Khaykovich, Forschungswissenschaftler am MIT und leitender Autor der neuen Studie. „Es sind noch weitere Forschungen erforderlich, um dies in die Praxis umzusetzen, aber die Studie schlägt eine für die Industrie attraktive Idee vor: Man muss möglicherweise nicht Hunderte von bestrahlten Proben zerbrechen, um ihren Versagenspunkt zu verstehen.“ Konkret zeigt die Studie einen Zusammenhang zwischen der Größe der Poren im Graphit und der Art und Weise, wie das Material quillt und schrumpft, was zu einer Verschlechterung führt.
„Die Lebensdauer von Graphit für nukleare Anwendungen ist durch strahlungsbedingte Quellung begrenzt“, sagt Mitautor und MIT-Forschungswissenschaftler Lance Snead. „Die Porosität ist ein entscheidender Faktor für diese Quellung, und obwohl Graphit seit dem Manhattan-Projekt intensiv für nukleare Anwendungen untersucht wurde, haben wir noch immer kein klares Verständnis der Porosität sowohl hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften als auch der Quellung. Diese Arbeit befasst sich damit.“
Ein seit langem untersuchtes, komplexes Material
Seit 1942, als Physiker und Ingenieure den weltweit ersten Kernreaktor in einem umgebauten Squashcourt an der University of Chicago bauten, spielt Graphit eine zentrale Rolle bei der Erzeugung von Kernenergie. Dieser erste Reaktor, der als „Chicago Pile“ bezeichnet wurde, bestand aus etwa 40.000 Graphitblöcken, von denen viele Uranklumpen enthielten. Heute ist Graphit ein wichtiger Bestandteil vieler in Betrieb befindlicher Kernreaktoren und wird voraussichtlich auch in Reaktoren der nächsten Generation, wie beispielsweise Salzschmelze- und Hochtemperatur-Gasreaktoren, eine zentrale Rolle spielen. Das liegt daran, dass Graphit ein guter Neutronenmoderator ist, der die bei der Kernspaltung freigesetzten Neutronen verlangsamt, sodass sie selbst eher Spaltungen hervorrufen und eine Kettenreaktion aufrechterhalten können.
„Die Einfachheit von Graphit macht es so wertvoll“, erklärt Khaykovich. „Es besteht aus Kohlenstoff, und es ist relativ gut bekannt, wie man es sauber herstellt. Graphit ist eine sehr ausgereifte Technologie. Es ist einfach, stabil und wir wissen, dass es funktioniert.“ Aber Graphit hat auch seine Komplexitäten. „Wir bezeichnen Graphit als Verbundwerkstoff, obwohl es nur aus Kohlenstoffatomen besteht“, sagt Khaykovich. „Er enthält ‚Füllstoffpartikel‘, die kristalliner sind, dann gibt es eine Matrix, die als ‚Bindemittel‘ bezeichnet wird und weniger kristallin ist, und dann gibt es Poren, deren Länge von Nanometern bis zu vielen Mikrometern reicht.“
Jede Graphitsorte hat ihre eigene Verbundstruktur, aber alle enthalten Fraktale, also Formen, die in verschiedenen Maßstäben gleich aussehen. Diese Komplexität macht es schwierig, die Reaktion von Graphit auf Strahlung im mikroskopischen Detail vorherzusagen, obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Graphit bei Bestrahlung zunächst verdichtet wird, wodurch sein Volumen um bis zu 10 Prozent reduziert wird, bevor es aufquillt und Risse bildet. Die Volumenschwankungen werden durch Veränderungen der Porosität und der Gitter Spannung des Graphits verursacht. „Graphit wird unter Strahlung beschädigt, wie jedes andere Material auch“, sagt Khaykovich. „Auf der einen Seite haben wir also ein Material, das extrem gut bekannt ist, und auf der anderen Seite ein Material, das immens komplex ist und dessen Verhalten sich durch Computersimulationen nicht vorhersagen lässt.“
Röntgenstreuung enthüllt das innere Verhalten bestrahlter Graphitproben
Für die Studie erhielten die Forscher bestrahlte Graphitproben vom Oak Ridge National Laboratory. Die Co-Autoren Campbell und Snead waren vor etwa 20 Jahren an der Bestrahlung der Proben beteiligt. Bei den Proben handelt es sich um eine Graphitsorte namens G347A. Das Forschungsteam verwendete eine Analysetechnik namens Röntgenstreuung, bei der die Streuintensität eines Röntgenstrahls zur Analyse der Materialeigenschaften genutzt wird. Konkret untersuchten sie die Verteilung der Größen und Oberflächenbereiche der Poren der Probe, also die sogenannten fraktalen Dimensionen des Materials.
„Wenn man sich die Streuintensität ansieht, erkennt man einen großen Bereich an Porosität“, sagt Fayfar. „Graphit weist eine Porosität in so großem Maßstab auf, und es gibt diese fraktale Selbstähnlichkeit: Die sehr kleinen Poren sehen ähnlich aus wie Poren, die sich über Mikrometer erstrecken. Deshalb haben wir fraktale Modelle verwendet, um verschiedene Morphologien über Längenskalen hinweg miteinander in Beziehung zu setzen.“ Fraktale Modelle wurden bereits zuvor für Graphitproben verwendet, jedoch nicht für bestrahlte Proben, um zu untersuchen, wie sich die Porenstrukturen des Materials verändern. Die Forscher fanden heraus, dass sich die Poren von Graphit zunächst füllen, wenn das Material bestrahlt wird, da es sich zersetzt.
„Was uns jedoch ziemlich überrascht hat, war, dass sich die Größenverteilung der Poren wieder umkehrte“, sagt Fayfar. „Wir hatten diesen Wiederherstellungsprozess, der mit unseren Gesamtvolumenplots übereinstimmte, was ziemlich seltsam war. Es scheint, als würde sich Graphit nach einer längeren Bestrahlung wieder erholen. Es ist eine Art Glühprozess, bei dem neue Poren entstehen, die sich dann glätten und etwas größer werden. Das war eine große Überraschung.“
Die Forscher fanden heraus, dass die Größenverteilung der Poren eng mit der durch Strahlenschäden verursachten Volumenänderung zusammenhängt. „Die Entdeckung einer starken Korrelation zwischen der Porengrößenverteilung und den Volumenänderungen des Graphits ist eine neue Erkenntnis, die einen Zusammenhang zum Versagen des Materials unter Bestrahlung herstellt“, sagt Khaykovich. „Es ist wichtig zu wissen, wie Graphitteile unter Belastung versagen und wie sich die Ausfallwahrscheinlichkeit unter Bestrahlung verändert.“
Von der Forschung zum Reaktor
Die Forscher planen, weitere Graphitsorten zu untersuchen und genauer zu erforschen, wie die Porengröße in bestrahltem Graphit mit der Ausfallwahrscheinlichkeit zusammenhängt. Sie vermuten, dass eine statistische Methode namens Weibull-Verteilung verwendet werden könnte, um die Zeit bis zum Versagen von Graphit vorherzusagen. Die Weibull-Verteilung wird bereits verwendet, um die Ausfallwahrscheinlichkeit von Keramik und anderen porösen Materialien wie Metalllegierungen zu beschreiben.
Khaykovich spekulierte auch, dass die Ergebnisse zu unserem Verständnis beitragen könnten, warum Materialien unter Bestrahlung verdichten und aufquellen. „Es gibt kein quantitatives Modell der Verdichtung, das berücksichtigt, was auf diesen winzigen Skalen in Graphit geschieht“, sagt Khaykovich. „Die Verdichtung von Graphit durch Bestrahlung erinnert mich an Sand oder Zucker, wo große Stücke zu kleineren Körnern zerkleinert werden und sich dadurch verdichten. Bei nuklearem Graphit ist die Zerkleinerungskraft die Energie, die Neutronen einbringen, wodurch große Poren mit kleineren, zerkleinerten Stücken gefüllt werden. Aber mehr Energie und Bewegung erzeugen noch mehr Poren, sodass Graphit wieder aufquillt. Es ist keine perfekte Analogie, aber ich glaube, dass Analogien zum Verständnis dieser Materialien beitragen.“
Die Forscher beschreiben die Arbeit als einen wichtigen Schritt, um Informationen über die Graphitproduktion und -verwendung in Kernreaktoren der Zukunft zu liefern. „Graphit wird schon seit sehr langer Zeit untersucht, und wir haben viele fundierte Erkenntnisse darüber gewonnen, wie es in verschiedenen Umgebungen reagiert, aber beim Bau eines Kernreaktors kommt es auf Details an“, sagt Khaykovich. „Die Leute wollen Zahlen. Sie müssen wissen, wie stark sich die Wärmeleitfähigkeit verändert, wie stark es zu Rissen und Volumenänderungen kommt. Wenn sich das Volumen von Komponenten verändert, muss man das irgendwann berücksichtigen.“