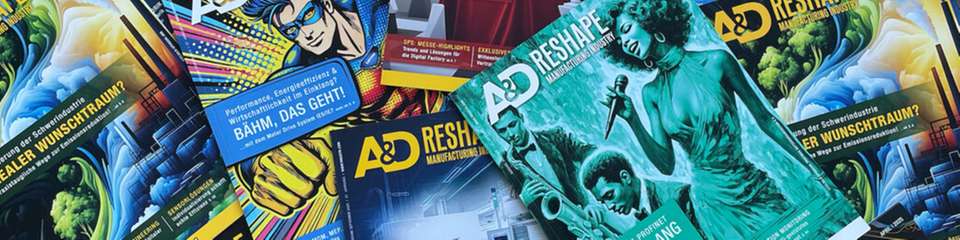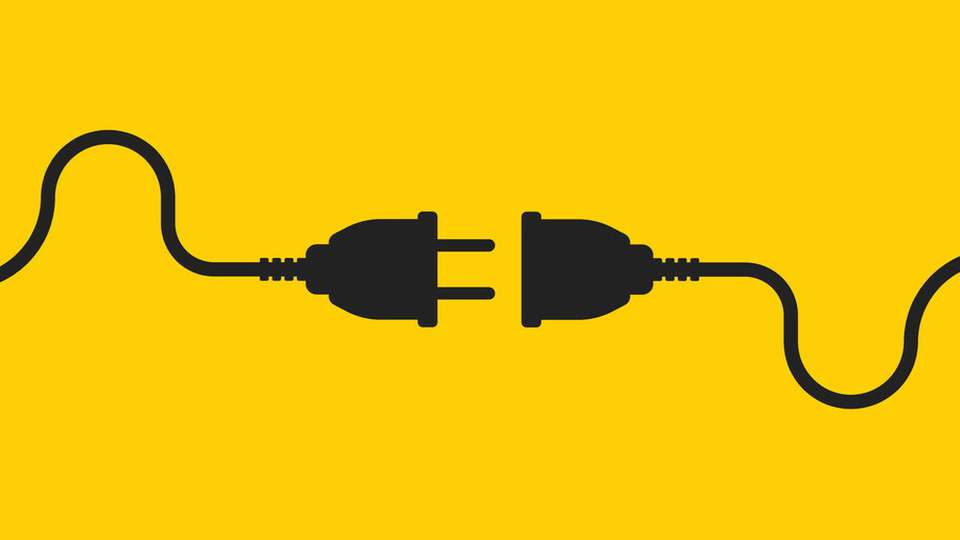Um Prozesse zu verbessern, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit in der Produktion zu erhöhen, werden in zentralen Einsatzfeldern im modernen Maschinenbau KI-basierte Softwaresysteme eingesetzt. Diese können zum Beispiel große Datenmengen analysieren und Verbesserungen für komplexe Produktionsabläufe vorschlagen.
Erkennbar ist dies bei automatisierten Parameteranpassungen aufgrund sich ändernder Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchte, Rohmaterial und mehr. Daraus entstehen viele Möglichkeiten zur Optimierung der Fertigungsprozesse. Allerdings müssen diese Technologien auch gewartet und bedient werden.
Gefährdungen bei der Mensch-Maschine-Interaktion
Während Maschinen früher vor allem über Schalter, Hebel, Handräder und Tasten gesteuert wurden, treten Menschen heute zunehmend über Touchscreens mit den Maschinen in Kontakt. Je komplexer die Automation dahinter aufgebaut ist, desto umfangreicher wird auch die Benutzeroberfläche der Bedienung. Immer mehr Daten verschiedener Sensoren werden miteinander kombiniert, um die Vorgänge zu erfassen und zu steuern, was nicht nur zu einer immer größer werdenden Komplexität, sondern auch zu neuen Gefährdungen führt. Technische oder funktionale Lösungen allein genügen dann häufig nicht, um Unfälle zu vermeiden. Außerdem werden die Maschinen auch von Personen bedient, die nicht ständig an den Anlagen arbeiten, wie zum Beispiel das Wartungs- oder Instandhaltungspersonal. Zeitdruck und Unachtsamkeit können dann zu Unfällen führen.
Die DGUV-Statistik zeigt, dass Instandsetzungen, regelmäßige Wartungen, Inspektionen und Reinigungen der betrieblichen Anlagen ein tödliches Risiko bergen. In den meisten Fällen werden die Anlagen vorschriftsmäßig abgeschaltet, jedoch können Restenergien in Druckspeichern oder Kondensatoren auch nach dem Abschalten der Anlage lebensgefährdende Situationen hervorrufen. Diese lassen sich unter anderem durch LOTO-Prozeduren eliminieren. LOTO ist die Abkürzung von Lock Out Tag Out, was ins Deutsche übersetzt „abschließen und kennzeichnen“ bedeutet. Beim LOTO-Verfahren geht es um das sichere Trennen von Energiequellen bei Wartungs-, Reparatur- oder Inspektionsarbeiten.
Das LOTO-Verfahren in der Praxis
In einem Produktionsunternehmen der Halbleiterindustrie müssen Fertigungsanlagen sehr genau arbeiten und durch den Einsatz von KI reagieren sie schon auf die geringsten Umgebungseinflüsse wie Veränderungen in der Luftfeuchtigkeit oder Staub in der Umgebungsluft. Ebenfalls wirken sich zum Beispiel Temperaturschwankungen bei der Herstellung von Leiterbahnen mit geringem Querschnitt aus, da die KI aufgrund der steuerungstechnischen Möglichkeiten geringste Abweichungen erkennt und entsprechend die Maschinenparameter automatisch anpasst. Eine in den Prozess involvierte Wetterprognose führt beispielsweise zu einer Temperaturanpassung, um zu verhindern, dass Ausschuss produziert wird. Früher mussten erfahrene Maschinenbediener die Maschinen manuell nachjustieren.
Damit die durch den KI-Einsatz entstandene Komplexität im Maschinenbau abgebildet werden kann, bedarf es einer gut durchdachten Bedienoberfläche. Denn die Anlagen sind nicht nur schwerer zu bedienen, sondern stellen auch bei Reparaturen oder Instandhaltungsarbeiten eine Herausforderung dar, insbesondere, wenn mehrere Fertigungsautomaten zur Fertigungslinie gehören, die durch kollaborierende Robotersysteme vernetzt sind. So können im Produktionsalltag zum Beispiel pro Schicht fünf Instandhaltungsmitarbeiter im Einsatz sein, die sich um die Betriebssicherheit, Produktivität und Langlebigkeit von 50 technischen Einrichtungen kümmern. Durch die Vielzahl der Maschinen und die Tatsache, dass Reparaturen nur bei Bedarf durchgeführt werden, kann man davon ausgehen, dass ein Instandhaltungsmitarbeiter nur alle zwei Jahre eine Reparatur an derselben Anlage durchführt. Daher kennt er die Steuerungssysteme und Produktionsabläufe nicht im Detail und ist auf eine intuitive Bedienung angewiesen, um im Reparaturfall einfach und schnell alle gefahrbringenden Energien wegschalten zu können.
Sind Mitarbeiter unter Zeitdruck oder anderen stressigen Einflüssen ausgesetzt, kann menschliches Versagen einen zentralen Risikofaktor darstellen. Um die damit einhergehende Gefahr zu vermeiden und gleichzeitig den gesetzlichen und behördlichen Anforderungen gerecht zu werden, kann das LOTO-Verfahren eingesetzt werden. Solange sich ein Unternehmen im Rahmen der Vorschriften und Gesetze bewegt, kann es in Deutschland selbst entscheiden, wie es umgesetzt wird. In der Praxis sollte es so gestaltet werden, dass es die Arbeit erleichtert. Das bedeutet, dass bei Maschinen, die neben elektrischer Energie auch über pneumatische oder hydraulische Einrichtungen verfügen, mehrere Abschaltpunkte an verschiedenen Positionen gegen das Wiedereinschalten gesichert werden müssen. Vereinfacht wird das Verfahren beispielsweise, wenn auf eine zusätzliche Dokumentation auf einem Zettel verzichtet wird, wenn die Informationen bereits über ein Betriebsdatenerfassungssystem eingegeben wurden.
Manipulationsanreize reduzieren
Durch den immer höheren Automatisierungsgrad und die Vernetzung von Fertigungsanlagen übernehmen Maschinen und Automaten (computergeführte Maschinen) Funktionen, die zuvor vom Menschen ausgeführt worden sind. Dies wirkt sich auf die Handlungen des Bedienpersonals bis hin zur Informationsverarbeitung und erhöhter computergesteuerter Mensch-Maschine-Interaktion aus. Sind diese zu komplex, überfordern sie das Personal, wenn sie nicht routiniert ausgeführt werden können. Zeitdruck birgt eine zusätzliche Gefahr zur Manipulation, wenn die Zykluszeit von der Automatisierungsanlage vorgegeben wird. Wird beispielsweise ein Mitarbeiter gelobt, weil durch die „Manipulation“ Zeit gespart wurde, oder wird Druck ausgeübt, wenn die Stillstände an den Maschinen zu groß sind, kann dadurch ebenfalls ein Manipulationsanreiz entstehen.
Hilfreich ist es, wenn die meist aufwendigen Abschaltprozeduren moderner Fertigungsanlagen für eine präventive Wartung genutzt werden, damit die Maschinen weitestgehend reibungslos weiterlaufen können. Denn bei nicht regelmäßiger Durchführung kann es zu ungeplanten Ausfällen kommen, so dass die Anlagen dann unter hohem Zeitdruck repariert werden müssen. Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, dass sich schwere Unfälle meist vor den Pausen oder zum Schichtende ereignen, da hier der Manipulationsanreiz aufgrund der Zeitersparnis durch das Abkürzen der aufwendigen Abschaltprozeduren am größten ist.
Sind Mitarbeitende mit den LOTO-Prozeduren vertraut und verstehen, warum diese notwendig sind, lassen sich Manipulationsanreize reduzieren. Daher ist es für ein nachhaltiges LOTO-Verfahren sinnvoll, klare Regeln aufzustellen und eine einheitliche Kennzeichnung individuell für die jeweilige Produktionsstätte einzuführen, die dann auch intensiv geschult wird.
Das Schutzkonzept muss zum Betreiber passen
Herausfordernd wird es im Alltag, wenn Sicherheitskonzepte wie Abschaltprozeduren oder weitere Schutzeinrichtungen bei Maschinen erst nachgezogen werden, wenn die prozesstechnischen Belange geklärt sind, da Sicherheitsabstände zu Gefährdungen nicht mehr eingehalten werden können, beziehungsweise ergänzende Schutzmaßnahmen technisch aufwendig und meist teuer realisiert werden müssen.
Je höher der Automatisierungsgrad einer Maschine und je komplexer die Steuerung durch eventuell eingesetzte KI ist, umso aufwendiger werden die Schutzkonzepte. Gut funktionierende Maschinen werden so zu Problemmaschinen mit geringerer Ausbringung und erhöhtem Ressourcenverbrauch. Zudem können Qualitätsstandards oft nicht gehalten werden, weil das Sicherheitskonzept nicht zu den prozesstechnischen Anforderungen des Betreibers passt.
Fazit
„Bei technischen Maßnahmen sollten Personen involviert werden, die entsprechende Fachkenntnis besitzen und in der Lage sind, die Maßnahmen sicherheitsgerichtet auszuwählen“, erklärt Johannes Spatz, Geschäftsführer bei Intecra, und führt fort: „Denn nur, wer die Umgebung des Betreibers mit allen daraus resultierenden Anforderungen an die Materialversorgung, Fertigungsbeobachtung und Variantenvielfalt beachtet, kann eine sichere und ressourceneffiziente Maschine herstellen, die den Kunden voll zufriedenstellt.“
Dazu zählt auch, den technologischen Fortschritt, die KI und den Schutz der Mitarbeiter ganzheitlich zu betrachten und zu berücksichtigen, dass Kosten besser planbar und günstiger sind, je früher man in der Planungsphase an die Integration von ganzheitlichen Sicherheitssystemen denkt.