Mit dem Einsatz von SiC-MOSFETs und Dioden verschieben sich die Grenzen in der Leistungselektronik spürbar. Höhere Sperrschichttemperaturen, deutlich kürzere Schaltzeiten mit entsprechend hohen dv/dt- und di/dt-Werten sowie die Möglichkeit, auf Systemebene mit stark gesteigerten Schaltfrequenzen zu arbeiten, ermöglichen kompaktere Module, die mehr Leistung auf gleicher Fläche unterbringen. Doch diese Vorteile haben ihren Preis: Die Verlustwärme konzentriert sich auf kleinstem Raum, häufig sogar in Form von Hotspots mit extremen Wärmeflussdichten. Was in der Theorie nach mehr Effizienz klingt, wird in der Praxis schnell zum thermischen Problem. Die eigentliche Grenze setzt nicht das Halbleiterbauelement selbst, sondern der Wärmepfad vom Chip bis ins Kühlmedium. Jede zusätzliche Schicht zwischen Halbleiter und Kühlkanal verlängert diesen Pfad, erhöht den thermischen Widerstand und ist zugleich eine potenzielle Schwachstelle für Alterungs- und Ausfallmechanismen.
Grenzen klassischer Kühlkonzepte
Traditionelle Modulkonzepte basieren auf einem Substrat, das auf einer massiven Baseplate sitzt und über eine Wärmeleitpaste oder ein Gap-Filler mit einer externen Kühlplatte verbunden wird. Der Wärmefluss muss dabei mehrere Übergänge überwinden: von der aktiven Halbleiterfläche über Metallisierungen, Keramik und Kupfer bis hin zu Füge- und TIM (Thermal Interface Material)-Schichten, bevor er schließlich die Kühlplatte erreicht. Die Konsequenz sind höhere Temperaturen am Halbleiter, größere Streuungen im Verhalten einzelner Module und ein erhöhtes Risiko für vorzeitige Ausfälle durch Alterungseffekte wie Pump-Out oder Rissbildung. Gleichzeitig wächst das Bauvolumen, was sich negativ auf Gewicht und Bauraum auswirkt – Faktoren, die insbesondere in der Elektromobilität kritisch sind.
Um diese Nachteile zu reduzieren, gehen die meisten Hersteller inzwischen dazu über, das Substrat direkt auf den Kühler zu löten oder zu sintern. Auf diese Weise entfallen nicht nur die Baseplate, sondern auch die dazwischenliegende TIM-Schicht, und der Wärmepfad verkürzt sich spürbar, da das Verbinden von Substrat und Kühler erst nach der Fertigstellung des vollbestückten Moduls erfolgt und damit zusätzliche Prozessschritte, Materialien, Toleranzen und Ausbeuteverluste einhergehen.
Curamik Micro Channel Cooler als Schlüsseltechnologie
Rogers geht hier noch einen entscheidenden Schritt weiter: Der Kühler wird nicht erst nachträglich gefügt, sondern bereits während der Substratherstellung direkt integriert. Damit entfallen weitere Schichten im System, und es entsteht eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung zwischen Substrat und Kühler. Grundlage dafür ist die von Rogers entwickelte Mikrokanalkühler-Fertigungstechnologie, die auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in thermisch anspruchsvollen Anwendungen baut.
Diese Technologie ermöglicht, komplexe 3-dimensionale Strukturen abzubilden, welche die Wärmeübergangseffizienz und die Kühloberfläche erheblich steigern. Gleichzeitig bleibt der Druckabfall im von der Automobilindustrie typischerweise geforderten Bereich von 100 bis 200 mbar, unter der Einhaltung der vorgeschriebenen Kanalbreiten größer 1,0 mm. Dabei handelt es sich streng genommen nicht mehr um klassische Mikrokanäle, sondern um Strukturen im Millimeterbereich. Dennoch erreicht dieses Konzept eine Effizienz, die mit der eines Mikrokanalkühlers vergleichbar ist. Der eigentliche Trick – und gleichzeitig die größte Herausforderung – liegt jedoch darin, die Durchbiegung des Substrats sowohl während des Herstellungsprozesses als auch in den nachfolgenden Kundenprozessen und in der finalen Anwendung zuverlässig zu kontrollieren.
Rogers ist es gelungen, auch bei einem unsymmetrischen Aufbau mit 0,5 bis 0,8 mm Kupfer auf der Layoutseite und einem Kühler auf der Rückseite mit bis zu 3 mm Stärke ein kontrolliertes Durchbiegungsverhalten zu erzielen. Damit können die Vorteile der Mikrokanalkühlung genutzt werden, ohne Einbußen bei mechanischer Stabilität und Zuverlässigkeit in Kauf nehmen zu müssen.
Thermische Performance in der Praxis
In der Anwendung zeigt sich die Stärke des Curamik-DirectCool-Konzeptes besonders deutlich. Der Wegfall weiterer Schichten im System reduziert den gesamten Junction-to-Fluid-Widerstand erheblich. Die Wärme fließt nun von der Halbleiterfläche über das direkt gekühlte Substrat unmittelbar in das Kühlmedium – ohne zusätzliche Schnittstellen. Die Leistungsfähigkeit konnte in einem gemeinsamen Demonstrator mit dem Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM eindrucksvoll belegt werden.
Die Versuche wurden auf eine besonders kompaktes 6-in-1-Modularchitektur ausgelegt. Unter anwendungsnahen Bedingungen — 363 A IMS (drei Chips), Tj,max = 150 °C, Kühlmitteltemperatur 65 °C und VDS = 1200 V — wurde ein Junction-to-Fluid-Wärmewiderstand von Rth,j-f = 0,158 °C/W (Durchfluss 10 L/min) gemessen. Für einen Worst-Case-Arbeitspunkt einer nahezu leeren Batterie bei 650 V Arbeitsspannung ergibt sich eine berechnete Wechselrichterleistung von 280 kVA, entsprechend rund 220 kW Motorleistung.
Fraunhofer IZM kombinierte das Substrat mit einer intelligenten und praxisnahen Schaltungs- und Ansteuerungsarchitektur, wodurch die Modul-Streuinduktivität, inklusive DC+- und DC−-Anschlüsse, mittels Simulation zu 3,23 nH bestimmt wurde. Leistungsdichten dieser Größenordnung, kombiniert mit einem Fertigungskonzept, das auf Skalierbarkeit und Kosteneffizienz ausgelegt ist, könnten einen neuen Standard setzen, der bislang nicht realisiert werden konnte.
Leichter, robuster, nachhaltiger – mehr als nur eine Kühlung
Neben den klaren thermischen Stärken bietet das Curamik DirectCool Concept auch mechanische, systemische und ökologische Pluspunkte. Der Verzicht auf eine massive Baseplate und traditioneller Kühlkomponenten reduziert das Modulgewicht spürbar – insbesondere, weil damit das Gewicht von Kühler und Baseplate praktisch eliminiert wird. Ein Vorteil, der sich insbesondere in der Elektromobilität direkt in mehr Reichweite und Effizienz übersetzt. Gleichzeitig folgt das Konzept dem Trend zur Miniaturisierung, da durch das verringerte Bauvolumen wertvoller Bauraum eingespart wird.
Die Vereinfachung des Aufbaus trägt zudem zu einer deutlich höheren Zuverlässigkeit bei: Weniger Schichten bedeuten zugleich auch weniger Schnittstellen, an denen Alterung oder Versagen einsetzen können. In umfangreichen Tests wurde das DirectCool Substrat mehr als 1.500 thermischen Wechselbelastungszyklen in passiven Kammern bei Temperaturen zwischen –55 und +150 °C ausgesetzt – ohne erkennbare Ermüdungserscheinungen. Damit eröffnet sich das Potenzial für Einsatzmöglichkeiten auch außerhalb des Automotive-Bereichs, deren Belastungsspezifikationen typischerweise zwischen –40 und +125 °C liegen.
Ein weiterer Vorteil liegt in der Ressourceneffizienz. Edelmetallreiche Zwischenlagen werden weitgehend vermieden, und auch beim Modul- und Systemhersteller sinkt der Bedarf an Material und Prozessschritten. Das spart Aufwand, senkt die Kosten und verbessert damit sowohl die ökonomische als auch die ökologische Bilanz. Rogers legt dabei besonderen Wert darauf, dass jede Innovation einen messbaren Beitrag für die Umwelt leistet.
Module-Designs neu denken
Das Curamik DirectCool Concept ist weit mehr als ein Fortschritt in der Kühlung – es verschiebt die Grenzen für das Design künftiger SiC-Module. Während klassische Kühllösungen an ihre physikalischen Barrieren stoßen, eröffnet DirectCool neue Freiheitsgrade in der Architektur. Entwickler können kompaktere und leistungsfähigere Module realisieren, die höhere Leistungsdichten mit gesteigerter Zuverlässigkeit verbinden.
DirectCool steht damit nicht nur für technische Innovation, sondern auch für eine neue Ära der Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Leistungselektronik. Als Schlüsseltechnologie, die den Anforderungen von morgen gewachsen ist, setzt es einen klaren Impuls für die Weiterentwicklung der Leistungselektronik – und bietet Entwicklern und Unternehmen gleichermaßen die Möglichkeit, nachhaltige und damit zukunftssichere Lösungen zu schaffen.






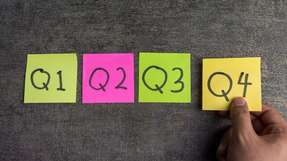


%20v2.jpg)


_ok.jpg)










