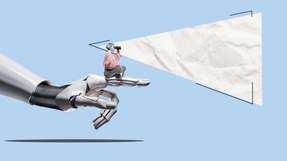Viele Fertiger zögern bei Digitalisierungsprojekten, da „Big-Bang“-Initiativen oft an hohen Kosten und Komplexität scheitern. Hier setzt SMKL an: Das Konzept basiert auf der japanischen Kaizen-Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung – lieber viele kleine Schritte als ein großer. Gemeinsam mit dem Kunden werden klare Ziele definiert, die in aufeinanderfolgenden Etappen erreicht werden. Statt alles mit Daten zu fluten, fokussiert SMKL auf relevante Informationen und bezieht die Mitarbeiter am Shopfloor aktiv ein. Dieses schrittweise Vorgehen mindert nicht nur Risiken, sondern schafft auch früh Erfolgserlebnisse.
Mitsubishi Electric liefert mit SMKL einen Fahrplan für die digitale Fabrik, bei dem jedes Investitionspaket mit konkretem Zweck und erwartbarem Nutzen und Return on Invest begründet wird. Das erleichtert Management-Entscheidungen erheblich. Optimierung ist nicht auf einzelne Maschinen beschränkt, sondern kann vom einzelnen Arbeiter über den Arbeitsplatz und die gesamte Fabrik bis hin zur Lieferkette ausgedehnt werden. Das Ziel: Transparenz und Effizienz auf allen Ebenen, ohne die Belegschaft zu überfordern.
Datenerfassung: Die Grundlage jeder Smart Factory
Am Anfang steht die Datenerfassung. Ohne Daten keine Digitalisierung – doch welche Daten, wie sammeln? Viele Fabriken verfügen bereits über einen Schatz an ungenutzten Informationen. SMKL propagiert: Erstmal die vorhandenen Daten einsammeln. Moderne Steuerungsplattformen wie der neue MELSEC MX Controller von Mitsubishi Electric helfen dabei. Dieser All-in-One-Controller vereint Ablaufsteuerung (PLC) und Motion-Control und verfügt ab Werk unter anderem über eine OPC UA-Schnittstelle sowie eine integrierte CC-Link IE TSN Netzwerkanbindung. Damit können Maschinendaten in Echtzeit und standardisiert ausgetauscht werden. KI-basierte Diagnose ist dabei ebenso kein Problem wie der Schutz vor unbefugten Zugriffen; die Cybersicherheit ist vom TÜV Rheinland nach IEC 624431-4-1 und 4-2 zertifiziert und CRA konform.
Auch bestehende Maschinen lassen sich anbinden. Der MX-Controller ist abwärtskompatibel zu bisherigen Mitsubishi Electric Steuerungen, was Budgets schont und den Retrofit erleichtert. Parallel können Sensoren und Aktoren aufgerüstet werden: etwa smarte Antriebe wie der neue kompakte FR-D800 Frequenzumrichter, der nicht nur energiesparend ist, sondern auch Zustandsdaten für die Instandhaltung liefert. Im Gegensatz zur früher oft praktizierten Daten-Hamsterei sorgt SMKL dafür, dass bereits an der Quelle gefiltert wird, welche Messwerte wirklich relevant sind. Die Praxis zeigt, dass Elektromotoren rund 45 Prozent der industriellen Elektrizität verbrauchen und hier enormes Einsparpotenzial schlummert. Veraltete Motoren können mit effizienteren Modellen ersetzt werden, was zweistellige Energieeinsparungen ermöglicht. Die Kosten für solche Upgrades amortisieren sich schnell, oft schon innerhalb von zwei Jahren.
Visualisierung: Transparenz schafft Vertrauen
Sind die relevanten Daten gesammelt, gilt es, daraus sichtbare Informationen zu machen. Die Visualisierung – Stufe B in SMKL – bringt Licht ins Dunkel der Fertigung. Was man nicht sieht, kann man nicht verbessern. Durch eingängige Darstellung von Produktionskennzahlen werden Probleme oft augenfällig: Der stillstehende Roboter, die Temperaturspitze im Ofen, der Engpass an Station 7 – all das springt ins Auge, wenn Dashboards und HMI-Bildschirme live mit Daten befüllt sind.
Moderne Bediengeräte wie das neue GOT3000 HMI setzen hier an. Mit hochauflösenden Multi-Touch-Displays bieten sie ein Fenster in die Anlage. Wichtig ist die Anbindung an verschiedenste Systeme: Die Panels verfügen über Dual-Ethernet-Ports und einen integrierten OPC UA-Server, um Daten aus Steuerungen aller gängigen Fabrikate zu sammeln. Ein Web-Browser ist ebenfalls eingebaut, was Remote-Zugriff erlaubt. So wird das HMI zum Datenknoten, der OT und IT verbindet. Über neue Schnittstellen lassen sich zusätzlich Informationen einblenden, die bisher nicht ohne Weiteres verfügbar waren. Ein Beispiel ist die Integration von Kamerasignalen direkt ins HMI – so kann etwa ein Qualitätsprüfungsbild oder der Blick ins Innere einer Maschine auf dem Panel angezeigt werden. Mit der GOT Mobile-Funktion können sich auch Tablets oder Smartphones kabellos mit der Visualisierung verbinden.
All diese Features sorgen für Transparenz in Echtzeit. Die Werker sehen sofort, was läuft und können eingreifen. Führungskräfte können live Kennzahlen verfolgen, ob am Schreibtisch oder mobil.
Analyse: Aus Daten werden Erkenntnisse
Daten zu haben ist gut – die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen ist aber noch besser. In der SMKL-Pyramide folgt auf die Visualisierung die Analyse (Stufe C). Hier geht es darum, die gesammelten Informationen systematisch auszuwerten. Moderne Softwarewerkzeuge wie die neue Digitalisierungs- und SCADA-Software Genesis Version 11 kommen in dieser Phase ins Spiel. Sie bildet gewissermaßen das Gehirn der smarten Fabrik: unbegrenzt skalierbar, mit integrierter Datenbank und leistungsfähigen Visualisierungs- sowie Analyse-Tools. Auffällig ist das Lizenzmodell: Der Nutzer kann beliebig viele Datenpunkte und Benutzer einbinden, ohne zusätzliche Lizenzgebühren. Dies ermöglicht es, wirklich alle relevanten Quellen im Betrieb anzuzapfen, seien es SPS, Sensor-Gateways, MES-Systeme oder Cloud-Dienste. Ziel ist ein ganzheitliches Datensammeln, ohne von vornherein durch Lizenzkosten begrenzt zu sein – und skalierbar in einzelnen Schritten die Digitalisierungsprojekte umzusetzen ohne in der Software beschränkt zu sein.
Technisch bietet Genesis V11 einen Industrial Historian, der große Datenströme speichert. Über Dashboards können Anwender Trends visualisieren und Berichte erstellen. Durch offene Standards lassen sich auch Fremdsysteme und -produkte integrieren. Dies ist entscheidend, da die Software als Übersetzer für die Daten aus verschiedenen Quellen fungiert. So können Daten aus Produktion, Qualität und Instandhaltung zusammenfließen. Künstliche Intelligenz hilft, Anomalien zu erkennen, was eine vorausschauende Wartung ermöglicht. Ein praktisches Beispiel: Aus der Analyse von Stromverbrauch und Vibrationsmustern lässt sich ableiten, wann ein Lager zu verschleißen droht. Das unterstützt das Wartungsteam und vermeidet ungeplante Ausfälle und Stillstandzeiten.
Ein weiterer Aspekt der Analysephase ist das Simulieren und Planen mit Digitalen Zwillingen. Dazu werden reale Anlagendaten in virtuelle Modelle eingespeist, um Szenarien gefahrlos durchzuspielen. Die potenziellen Einsparungen sind enorm: Würde man weltweit nur 25 Prozent der neu verkauften Elektromotoren mittels Digital Twin exakt auslegen, könnten jährlich rund 500 Millionen € Stromkosten und 2 Milliarden € Investitionskosten vermieden werden. Analyse heißt nicht nur rückwärts schauen, sondern auch vorausschauend planen.
Optimierung: Kontinuierlich besser werden
Die letzte Stufe – Optimierung – ist das Ziel aller vorherigen Schritte. Hier fließen Erkenntnisse zurück ins operative Geschäft: Prozesse und Maschinenparameter werden fortlaufend angepasst. SMKL versteht Optimierung als kontinuierlichen Zyklus. In der Praxis bedeutet das, Produktionsanlagen adaptiver zu machen. Erkennt die Analyse Engpässe, kann die Produktionsreihenfolge optimiert werden. Zeigen Qualitätsdaten, dass eine bestimmte Temperaturkurve weniger Ausschuss produziert, wird die Steuerung feinjustiert. Moderne Automatisierungsgeräte wie der MELSEC MX Controller unterstützen dies durch KI-gestützte Programm-Analyse, um Engpässe zu identifizieren und zu beheben. Er kann auch Fehlerursachen automatisch aufzeichnen und auswerten, was die Anlagenverfügbarkeit steigert.
Interoperabilität: Alt und Neu verbinden
Ein häufig unterschätzter Erfolgsfaktor ist die Integration bestehender Lösungen. Kaum ein Werk kann es sich leisten, alle Maschinen und Systeme auszutauschen. SMKL trägt dem Rechnung, indem es Interoperabilität forciert. Glücklicherweise folgt die Industrie hier immer stärker offenen Standards. Der MELSEC MX Controller mit OPC UA und TSN kann Daten auch von Drittanbieter-Geräten austauschen. Die neuen FR-D800 Frequenzumrichter wiederum unterstützen mehrere Ethernet-Protokolle parallel. Das heißt, sie finden Anschluss in bestehende Profinet-, EtherNet/IP- oder Modbus-Netzwerke, ohne dass Gateways nötig sind. Die GOT3000-HMIs sind nicht auf Mitsubishi Electric-Steuerungen beschränkt. Sie unterstützen eine Vielzahl von Treibern, OPC und sogar direkte Datenbankanbindungen, um Informationen aus MES- oder ERP-Systemen anzuzeigen. Damit wird das HMI direkt zu einem Gateway. Auf der Softwareseite ist Genesis V11 bewusst als herstellerneutrale Datenplattform konzipiert. Insgesamt lässt sich festhalten: Die neuen Lösungen achten darauf, investitionsschonend und einfach integrierbar zu sein. Unternehmen können so schrittweise modernisieren. Das verringert nicht nur Kosten, sondern erleichtert auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern.
Fazit: Zukunftssicherung durch schrittweise Digitalisierung
Die Smart Manufacturing Kaizen Level zeigen, dass digitale Transformation kein einmaliges Großprojekt sein muss, sondern ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess ist. Statt im Aktionismus teure Insellösungen anzuschaffen, folgt man einem strategischen Fahrplan von der Datenerfassung bis zur Optimierung. Jeder Schritt, bei dem Mitsubishi Electric Industrieunternehmen kontinuierlich begleitet, liefert echten Mehrwert: Transparenz, Effizienz, Qualität und letztlich Wettbewerbsfähigkeit.






.jpg)