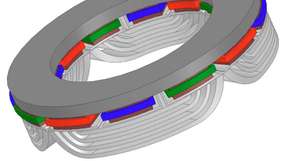Welche konkreten Initiativen und Ziele verfolgen Sie mit Ihren drei Ökosystem-Säulen für Kunden, Start-ups und Partner?
Das Fundament unserer Business-Ökosystem-Strategie ist ein Cross-Company-Modell. Dabei verfolgen wir die Maxime des Wissenstransfers, um Silobildung erst gar nicht entstehen zu lassen – weder intern bei Vinci Energies noch nach außen hin. Wir setzen also gezielt darauf, Know-how nicht nur zwischen Abteilungen, Business Units und einzelnen Teams miteinander zu teilen, sondern auch in Form umfassender Partnerschaften. Daraus ergeben sich die drei Ökosystem-Säulen aus der Kooperation mit Kunden, Start-ups und Partnern. Zugleich sind diese drei miteinander verwoben. Denn um das konkrete Ziel, kommerzialisierbare Lösungen, zu erreichen, nutzen und verknüpfen wir das Wissen und die Fähigkeiten aus dem Ökosystem. Hat ein Kunde beispielsweise spezielle Herausforderungen, so könnte sich eine mögliche Lösung hinter dem Angebot eines Start-ups verbergen. Möglicherweise braucht es dann noch Ansätze von uns oder einem unserer Technologie-Partner, um Lücken zu füllen und so schließlich eine passgenaue digitale Anwendung für den Kunden zu realisieren. Über solche Initiativen lernen Start-ups unsere Kunden kennen, Partner können ihre theoretischen Ansätze in die Praxis überführen und Kunden erhalten konkrete Technologien und Services. Während des gesamten Prozesses steuern wir selbst unser Know-how bei, gewinnen und teilen zusätzliches Wissen und entwickeln parallel neue Ideen. Wie beim Vorbild aus der Natur profitieren am Ende alle Mitglieder eines Ökosystems, werden klüger, stärker und resilienter.
Welchen konkreten Nutzen ziehen Ihre Kunden aus der Industrie aus der Zusammenarbeit mit Start-ups über Ihre Programme wie Startup Connect?
Start-ups haben sehr häufig ein eigenes Mindset, welches sich von traditionellen Mustern der Problemlösung unterscheidet. Dadurch sind sie oft ungehemmter, offener und experimentierfreudiger – kurz: sie gehen neue innovative Wege. Indem wir parallel dazu unsere jahrzehntelange Erfahrung einbringen, schaffen wir den notwendigen Rahmen. Immerhin gehört zu einem Business Case nicht nur die Frage nach dem Ob. Genauso wichtig ist die Frage nach dem Wie. Denn es gibt Vorschriften, Regularien, ökonomische wie ökologische Aspekte und kundenspezifische Anforderungen, die ein ganzes Bündel an Bedingungen vorgeben. Die Experten aus unseren Marken und Business Units können so nicht nur geeignete Start-ups aus dem Pool von Startup Connect identifizieren und auswählen. Während der Projekte erkennen sie auch frühzeitig Stolpersteine und geben sichere Pfade vor. Damit erhalten unsere Kunden aus der Industrie das Beste aus zwei Welten: Praxiserfahrung und unbekümmerten Innovationsgeist.
Sie bieten auch ein Business Development Management Programm an: Ist die vorrangigste Frage vor der Digitalisierung: Wie kann ich mein bisheriges Geschäftsmodell zerstören? Weil wenn ich keine Antwort darauf habe und gerüstet bin, macht es jemand anderes!
Frei nach Schumpeter findet auch bei der Digitalisierung eine Form der »schöpferischen Zerstörung« statt. Bisherige Geschäftsmodelle können dabei hinterfragt, müssen aber nicht zwangsläufig über den Haufen geworfen werden. Denn die Digitalisierung ist zunächst einmal ein hilfreiches Tool, das Prozesse vereinfacht, verbessert und effizienter macht – und manchmal ganz überflüssig. Unternehmen aus der Industrie können etwa ihre Anlagen produktiver und wartungsärmer gestalten. Durch moderne Sensorik und intelligente Datenanalyse lassen sich Ausfälle, zum Beispiel in Umspannwerken, vermeiden. Bei unserem Business-Development-Management-Programm erarbeiten wir mit den Teilnehmenden Wege und Strategien, um Lösungen für ein bestimmtes Problem zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht dabei der Business Case – also wie lässt sich mittels Tools aus dem Baukasten der Digitalisierung eine Anwendung erstellen, die eine konkrete Herausforderung meistert. Ein Beispiel dafür ist etwa die Low-Code-Programmierung. Für bestimmte Programmieraufgaben eignet sie sich ideal, um etwa schnell und kostensparend Apps zu entwickeln. So lassen sich schnell Marktpotenziale testen, ohne aufwendige Softwareentwicklungsprojekte.
Ist die Digitalschmiede im Hinblick auf Innovationen in der Industrie als eine Art "Partnervermittlung" zu verstehen?
Wenn Sie es so definieren wollen, ja! Doch es ist nicht nur die Digitalschmiede, die Partner zusammenbringt. Es ist unsere Vision und Mission, dass Erfolg auf einem konstruktiven Miteinander basiert. Nehmen Sie etwa die vor uns liegenden Herausforderungen durch den notwendigen ökologischen Wandel. Diese werden immer komplexer und betreffen alle Branchen gleichermaßen. Um in diesem Umfeld echte Innovationen hervorzubringen, müssen sich Unternehmen vom Denken im reinen Wettbewerb lösen und stattdessen stärker miteinander vernetzen und dabei einen konstruktiven Austausch von Know-how ermöglichen. Denn selbst große Konzerne sind nicht mehr in der Lage, in Eigenregie das erforderliche Wissen vorzuhalten. Im Vordergrund steht daher der Wissenstransfer. Die Digitalschmiede bietet dazu einen physischen Raum, in dem auch Tech Talks, Hackathons und Design Thinking Workshops stattfinden und neben internen Teams aus dem Vinci-Energies-Netzwerk auch Kunden sowie Partnern gleichermaßen offensteht. Sie ermöglicht dadurch auch ein ungezwungenes Kennenlernen, um Know-how auszutauschen und schließlich neue Partnerschaften einzugehen. Sie ist aber nur ein Teil unseres Business Ökosystems, zu dem auch das bereits erwähnte Programm Startup Connect gehört, das die Kooperation mit Start-ups forciert und koordiniert. Wir nutzen demnach verschiedene Möglichkeiten des Austauschs, um schließlich auch geeignete interne wie externe Partner zu vermitteln.
Partnerschaften und Kooperation sorgen für schnellere Time-to-Market und ganzheitliche Lösungen, verwässern aber auch die Gene und USPs eines Unternehmens. Wo öffnet man sich, wo baut man Know-how auf… Sind das Bedenken Ihrer Kunden?
Jedes Unternehmen hat seine eigenen Besonderheiten und Stärken, die es durch mehr Kooperation auch nicht verliert. Immerhin zielen wir in unserem Business Ökosystem genau darauf ab, dass sich unsere Partner gegenseitig ergänzen und dabei ihre eigenen USPs weiter vertiefen und ausbauen können. Bei potenziellen Partnern achten wir deshalb darauf, dass sie ein entsprechendes Mindset mitbringen, sich aktiv einbringen und zugleich die Möglichkeit erhalten, ihr eigenes Business auszubauen. Bietet beispielsweise ein Unternehmen eine Softwarelösung zur Erstellung digitaler Zwillinge an, kann es durch den Zugang zu unserer Expertise und unseren Technologien die eigenen Fähigkeiten potenzieren. Wir können dadurch unseren Kunden zusätzliche Lösungen bereitstellen, von denen sie profitieren. Auch in natürlichen Ökosystemen gelingt es nur durch Symbiose, dass sich Pflanzen und Tiere spezialisieren und erfolgreich sein können.
Wie stark beeinflussen KI und GenAI die Dringlichkeit der Digitalisierung und Ökosystemarbeit in der Industrie?
KI und Generative AI sind die neuen Gamechanger bei der Digitalisierung. Aus Jahrzehnten an Erfahrung verfügen wir allein in unserem Vinci Energies-Netzwerk über einen riesigen Fundus an Daten und es kommen täglich neue hinzu. Das gilt ebenso für unsere Kunden und Partner. Mittels KI lassen sich diese Daten optimal nutzen, um bestehende Anwendungen zu verbessern oder neue Anwendungen zu entwickeln, die etwa für mehr Effizienz und höhere Sicherheit sorgen und dabei weniger Ressourcen verbrauchen. So nutzen wir KI beispielsweise bei der Bilderkennung – etwa als Showcase in der Digitalschmiede zur Überwachung gefährdeter Bereiche und der Nutzung einer PSA oder in einer eigens entwickelten App, die Sprachbarrieren bei internationalen Teams überwindet. Business Ökosysteme bieten für die Anwendung von KI einen optimalen Rahmen. Denn durch den Wissenstransfer lassen sich auch Daten zusammenführen und nutzenbringend auswerten. Daraus ergeben sich ganz neue Erkenntnisse und gewaltige Synergien für alle Beteiligten. Umfassende Maßnahmen, um Daten zu sichern und zu schützen, beugen Missbrauch oder Verlust vor. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Daten vor der Verarbeitung durch eine KI zu anonymisieren – immerhin kann es sich um hochsensible Unternehmensdaten handeln. Bei allem sollte aus unserer Sicht aber eine Sache im Vordergrund stehen: KI sollte und kann nicht dazu dienen, Menschen zu ersetzen. Vielmehr ist sie dazu da, die Arbeit zu erleichtern und sicherer zu machen.
Nicht neu die Frage: Worin sehen Sie nach wie vor die größten Hindernisse oder Probleme, wenn Sie Unternehmen bei der Transformation helfen?
In einigen Unternehmen herrscht noch immer ein Silodenken, das sich auch im Umgang zwischen einzelnen Abteilungen zeigt. Hier besteht eine gewisse Hemmnis, sich gegenüber anderen zu öffnen und Know-how zu teilen. Dahinter steht auch keine böse Absicht. Vielmehr ist es die Vorstellung, dass es sich um Spezialwissen handelt, mit dem andere Abteilungen nichts anfangen können. Das ist aber ein Trugschluss. Denn nur wenn Wissen teamübergreifend geteilt wird, können sich daraus neue Ideen entwickeln, an die zuvor niemand gedacht hat. Das ist besonders für die digitale Transformation wichtig. Ihr Erfolg hängt davon ab, dass unterschiedliche Erfahrungen, Expertisen und Arbeitsweisen zusammenfließen. Nur so lassen sich digitale Lösungen entwickeln, die sich nach dem tatsächlichen Bedarf ausrichten. Deshalb motivieren wir Unternehmen dazu, neben dem externen auch den internen Austausch zu stärken.
Empfehlen Sie Kunden idealerweise auch „Change Agents“ in jeder Abteilung, die die Digitalisierung verstehen, begeistert sind und den Kollegen so die Vorteile nahebringen können?
Statt sogenannte Change Agents in den einzelnen Abteilungen zu etablieren, empfehlen wir auch hier einen eher übergreifenden Ansatz. Zunächst einmal muss Digitalisierung als Führungsaufgabe verstanden werden. So sollten Führungskräfte einen Blick dafür haben, welche Prozesse von Digitalisierung und KI profitieren können und die entsprechenden Veränderungen anschieben und ermöglichen. Dann sollten diejenigen, die für die Digitalisierung in Unternehmen zuständig sind, nicht in jeder einzelnen Abteilung sitzen. Sie müssen aber ihre Rolle verstehen und leben. Ich nutze hier gerne die Bezeichnung „Domestiken“ wie im professionellen Radsport. Denn wie ihre sportlichen Vorbilder erfüllen Digitalisierer die Aufgabe, eigene Ziele zurückzustecken und stattdessen den Gesamterfolg im Blick zu behalten. Dazu arbeiten sie ihren Kolleginnen und Kollegen zu, indem sie etwa den kontinuierlichen Austausch suchen. Zum einen, um deren Bedürfnisse zu kennen, zum anderen, um sie gezielt mit Impulsen und innovativen Ideen zu versorgen. Die hier herrschende Wechselwirkung beim Austausch ist nichts anderes als der durchgehende Wissenstransfer, den Digitalisierer fördern sollten. Nur so schaffen sie es, passgenaue und am Bedarf orientierte Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen.
„Digitalschmieden“ gibt es viele: Was zeichnet Vinci Energies aus, warum sollten sich Kunden an Sie wenden?
Häufig verfolgen sogenannte Innovation Labs lediglich das Ziel, Proofs of Concepts zu generieren. Sie sollten aber nicht dabei stehenbleiben, sondern aktiv an der Implementierung mitwirken – also Lösungen entwickeln, die auf die Praxis ausgerichtet und damit wirtschaftlich verwertbar sind, ohne dabei zu risikoavers und innovativ zu sein. Genau daran orientieren wir uns bei Vinci Energies und unserer Digitalschmiede. Statt in einem eigenen Kosmos vor uns hin zu innovieren, fokussieren wir uns gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern an den Herausforderungen, vor denen sie im praktischen Business-Alltag stehen. Das gilt ebenso für die Erfahrungen, die unsere Marken in ihrem alltäglichen Geschäft machen, und daher genau wissen, an welcher Stelle es Optimierungsbedarf gibt. Dabei muss nicht jedes Mal das Rad neu erfunden werden, um Innovationen anzuschieben. Stattdessen greifen wir auf zahlreiche Technologien zurück, verbessern diese oder kombinieren sie neu. Dazu dient auch der Wissenstransfer. Indem wir Know-how und Ideen miteinander teilen, schaffen wir die Grundlage für umfassende Lösungskompetenz. Ergebnisse daraus können Besucher:innen in der Digitalschmiede anhand der dort ausgestellten Use Cases live erleben. Von digitalen Zwillingen über Energiemanagementsysteme bis hin zu Lösungen zur Prozessindustrie und IT/OT-Sicherheit zeigen wir, was möglich ist – und haben bei Gästen schon für so manche Inspiration gesorgt.