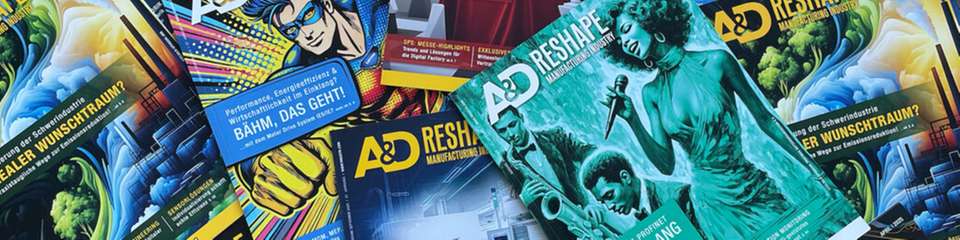PI steht für bewährte Kommunikationsstandards. Wie gelingt es, angesichts der wachsenden technologischen Vielfalt eine einfache und transparente Kommunikation zu realisieren?
Schmidt:
Angesichts von Herausforderungen wie Dekarbonisierung, Fachkräftemangel oder digitaler Transformation sehen wir es als unsere Aufgabe, mit innovativen Technologien konkrete Verbesserungen für Industrie und Gesellschaft zu schaffen. Neue Technologien bringen naturgemäß Komplexität mit sich – unser Anspruch ist es, diese durch klare Struktur, gute Werkzeuge und durchdachtes Design für den Nutzer unsichtbar zu machen. Ein Beispiel ist das Smartphone: technisch hochkomplex, aber intuitiv bedienbar. Genau das verfolgen wir auch bei PI. Technologien wie IO-Link, Profinet, Omlox oder MTP sollen leistungsfähig und zugleich anwenderfreundlich sein – im Engineering wie im Betrieb. Dabei ist Interoperabilität entscheidend: Komponenten verschiedener Hersteller müssen nahtlos zusammenarbeiten. Semantische Interoperabilität ist dabei zentral. Bereits bei Profinet haben wir mit standardisierten Diagnosemeldungen Pionierarbeit geleistet. Heute gehen wir weiter – mit OPC UA Companion Specifications, der Integration von eCl@ss und dem Ziel, industrielle Daten standardisiert, semantisch einheitlich und maschinenlesbar bereitzustellen.
Moritz:
Aus technologischer Sicht ist es entscheidend, dass neue Entwicklungen wie SPE nicht als Insellösungen entstehen, sondern gezielt Lücken im Automatisierungs-Stack schließen. IO-Link entstand aus dem Bedarf, intelligente Kommunikation bis in kleinste Sensoren zu bringen – in 4 mm breite Sensoren passt nun mal kein Ethernet-Knoten. Auch SPE verfolgt das Ziel, Ethernet bis zum Sensor zu bringen – ein logischer nächster Schritt. Unsere Aufgabe bei PI ist es, diese Bausteine in ein kohärentes System zu integrieren – einfach für den Anwender, klar für den Hersteller. Dafür braucht es durchgängige Datenmodelle, die Informationen aus Sensoren, Aktoren und Steuerungen einheitlich in übergeordnete Systeme übertragen. Das umfasst nicht nur Syntax, sondern auch Semantik. Die IODD ist dabei eine tragfähige Grundlage. Je weiter Daten in höhere Ebenen wandern – etwa für Predictive Maintenance oder KI – desto wichtiger wird die semantische Eindeutigkeit. Semantik ist daher kein Add-on, sondern ein zentrales Element moderner Kommunikation.
Wie ergänzen sich denn Technologien wie IO-Link, Single Pair Ethernet (SPE) und Ethernet-APL in einer modernen Automatisierungsarchitektur?
Moritz:
Die drei Technologien decken unterschiedliche Bedarfe ab und sind deshalb komplementär. IO-Link ist besonders für einfache, kostensensitive Anwendungen im unteren Leistungsbereich optimiert. Es eignet sich ideal für Sensoren mit begrenztem Platzangebot, niedrigem Energieverbrauch und geringem Datenaufkommen. SPE bringt Ethernet in eine neue physikalische Form: Über nur zwei Adern lassen sich Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen – und gleichzeitig Spannungsversorgung realisieren. Ethernet-APL ist wiederum für die Prozessindustrie mit Ex-Zonen konzipiert, bringt ähnliche Vorteile, aber mit besonderem Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Manche sagen, SPE werde IO-Link verdrängen. Das mag sehr langfristig vielleicht der Fall sein, aber sicher nicht kurzfristig. Ein Mini-Induktivsensor kostet heute etwa 10-15 Euro; da kann man nicht für sechs Euro Ethernet einbauen. Wäre SPE so günstig und einfach verfügbar wie ein IO-Link Interface, dann könnte es zu einem Verdrängungswettbewerb kommen.
Schmidt:
Wir sehen bei PI unsere Aufgabe aber auch darin, diese Technologien nicht gegeneinander zu stellen, sondern gemeinsam in eine interoperable Systemarchitektur zu überführen. Es gibt Überschneidungen, aber keine zwingenden Verdrängungseffekte. Vielmehr geht es darum, für jede Anwendung die bestmögliche technische Lösung zu bieten. Dabei spielen nicht nur Performancekriterien eine Rolle, sondern auch Aspekte wie Kosten, Verfügbarkeit, mechanische Anforderungen oder bestehende Infrastruktur. Wir geben den Anwendern die Freiheit, auf Basis standardisierter Schnittstellen die für sie passende Kombination zu wählen.
Sehen Sie IO-Link also weiterhin als Schlüsseltechnologie zur Modernisierung von Anlagen?
Moritz:
Ja, und die Wachstumsrate von IO-Link ist mit durchschnittlich 35 Prozent pro Jahr immens – eine Sättigung ist nicht in Sicht. Das zeigt, dass IO-Link eine robuste, breit akzeptierte Technologie ist. Sie hat sich von einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Kommunikation zu einer vielseitigen Plattform entwickelt. Besonders spannend sind Erweiterungen wie IO-Link Wireless für bewegte oder schwer zugängliche Anwendungen und IO-Link Safety, das durch die Anbindung an Profisafe auch sicherheitsgerichtete Kommunikation ermöglicht. Mit der neuen Zeitstempel-Funktion wird IO-Link zudem für hochdynamische, synchronisierte Prozesse interessant. Parallel treiben wir applikationsspezifische Profile voran – etwa für RFID, Drucksensorik oder Prozessanwendungen –, die die Integration weiter vereinfachen.
Vom Sensor direkt hoch bis in die Cloud heißt es gerne bei SPE. Das zeigen Sie jetzt aber auch mit IO-Link…
Moritz:
Ja, es ist eine flexible Ergänzung. Die SPS ist primär für die Maschinensteuerung, Prozessdaten und Echtzeitkommunikation zuständig. Andere Daten – Diagnose, Monitoring, Asset Management – können durch die SPS geleitet werden, aber auch direkt vom IO-Link-Master, parallel zur SPS, in eine höherwertige Ebene wie die Cloud transportiert werden. Viele IO-Link-Master haben diesen zweiten Weg implementiert. Das war auch der Trigger, dieses zweite Interface zu standardisieren, auch für Use Cases ohne PLC. Ein Beispiel ist die Schneehöhenmessung für Meteo France in den Alpen, wo ein industrieller IP67-Sensor seine Daten per Funk über einen IO-Link-Master mit JSON-Record überträgt, ohne PLC oder Profinet vor Ort.
Schmidt:
Auch mit Profinet können wir seit Jahren Daten parallel an der SPS vorbei nach oben führen. Das ist ein Riesenvorteil von Profinet: Ich kann auf Daten zugreifen, auch wenn die SPS nicht läuft, bin unabhängig und entlaste die SPS. Angesichts steigender Datenmengen ist das die richtige Architektur, um nicht durch den Flaschenhals einer SPS zu müssen. Natürlich hat die SPS-Einbindung Vorteile, etwa den Kontext der Daten zum PLC-Programm. Aber es gibt viele Use Cases, wo der direkte Datenweg sinnvoll ist, sei es über direkten Zugriff auf Profinet Datenrecords oder integrierte Protokolle wie MQTT oder OPC UA. Dieser Datenzugang ist ein Riesenvorteil unserer Architektur.
Moritz:
Ergänzend ist es ein großer Vorteil von Profinet, dass über dieselbe Leitung parallel mehrere Protokolle störungsfrei laufen können, z.B. auch TCP/IP-Protokolle oder eine REST API. Das ist nicht bei jedem Feldbussystem gegeben.
Bei SPE gab es anfangs eine gewisse Unübersichtlichkeit durch verschiedene Ansätze. Wie geht PI hier vor, um Einheitlichkeit für die Anwender zu schaffen?
Schmidt:
SPE wurde unter anderem von der Automobiltechnik vorangetrieben, was zu verschiedenen Standards führte. Unser Job als Automatisierer ist es, aus diesen Standards das für uns Passende auszuwählen, da wir andere Stückzahlen und Anforderungen haben. Es ist unsere Aufgabe als PI, einen gemeinsamen Standard zu etablieren, um es für unsere Anwender einfacher zu machen. Wir schauen zuerst, was vorhanden ist, und wo etwas fehlt, definieren wir gemeinsam Neues oder ergänzen Bestehendes, wie bei eClass, wo wir Properties für Profinet oder IO-Link eingebracht haben. Genau das machen wir jetzt mit dem Standard Profinet over SPE.
Moritz:
Ein Ziel ist es auch, Hinderungsgründe für die SPE-Integration in Sensoren auszuräumen. Das betraf beispielsweise die Standardisierung eines Steckers, der nun von allen akzeptiert wird, oder die Definition passender Power Classes. Hier sind wir bei PI dabei, die APL Power Classes so zu übernehmen, dass sie auch für General Purpose SPE passen. Wenn wir da durch sind, haben Sensorhersteller eine Basis, um SPE ohne Entwicklungsrisiko zu integrieren.
Welche Rolle spielt OPC UA im Zusammenspiel mit Profinet und IO-Link?
Schmidt:
OPC UA ist für uns die Schlüsseltechnologie für vertikale Integration. Die Stärke liegt in der Objektmodellierung, die es erlaubt, komplexe Zusammenhänge systematisch zu beschreiben. Wir nutzen OPC UA dort, wo es sinnvoll ist, etwa in der Verbindung von Steuerungsebene und IT-Systemen oder in der Umsetzung von Energiemanagement-Anforderungen. Unsere Companion Specifications – entwickelt mit Partnern wie VDMA und OPC Foundation – schaffen hier standardisierte Schnittstellen, die unter anderem auch in der Prozessindustrie oder für MTP-Anwendungen zum Einsatz kommen.
Moritz:
Auch für IO-Link gibt es ein standardisiertes OPC-UA-Mapping. Der IO-Link Master fungiert in diesem Fall als OPC-UA-Server und bietet gerätespezifische Informationen auf Basis der IODD an. Alternativ existiert auch ein JSON/REST-Ansatz, der einfacher zu integrieren und besonders für kostensensitive Anwendungen attraktiv ist. Beide Wege haben ihre Berechtigung. Entscheidend ist, dass die Semantik erhalten bleibt und eine durchgängige Nutzung der Daten in höheren Systemen möglich ist.
Wie steht es um die Security bei PI-Technologien?
Schmidt:
Sicherheit ist kein nachträglich aufgesetztes Feature, sondern ein integraler Bestandteil unserer Technologiearchitektur. Wir betrachten Security ganzheitlich – von der Spezifikation über Entwicklungsrichtlinien bis hin zur Anwenderunterstützung. Dazu gehören unter anderem Secure Development Lifecycle (SDL), Patch- und Update-Management sowie Incident-Response-Prozesse. Speziell bei Profinet haben wir Security-Klassen definiert, die den Schutzbedarf je nach Anwendung adressieren. Wir arbeiten kontinuierlich daran, diese Mechanismen weiterzuentwickeln und auf andere Technologien zu übertragen. Ziel ist, dass unsere Nutzer auf allen Ebenen ein gleichbleibend hohes Sicherheitsniveau vorfinden.
Moritz:
Auch IO-Link wird unter Security-Gesichtspunkten genau analysiert. Bei klassischen, verdrahteten Anwendungen ist das Risiko gering, aber mit IO-Link Wireless verändert sich die Angriffsfläche. Daher entwickeln wir gezielte Sicherheitsstrategien und haben beispielsweise einen Deployment Guide herausgegeben, der praxisnah beschreibt, wie IO-Link sicher in Maschinen integriert werden kann. Besonders wichtig ist uns ein technologieübergreifender Ansatz: Security muss bei PI einheitlich gedacht und umgesetzt werden, um Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit sicherzustellen.
Ein Blick nach vorn: Was wünschen Sie sich für die kommenden Jahre?
Moritz:
Mein Wunsch ist, dass die hohe Akzeptanz unserer Technologien anhält und wir weiterhin neue Geräte, Anwendungsfelder und Branchen erschließen. Besonders wichtig ist mir, dass die Sicherheitsanforderungen mitwachsen und konsequent umgesetzt werden. Nur so behalten wir das Vertrauen der Industrie.
Schmidt:
Ich wünsche mir, dass wir den Fokus wieder stärker auf Innovation und Technologietransfer legen können. Unsere Aufgabe ist es, den technologischen Rahmen zu schaffen, damit unsere Mitglieder und Partner mit ihren Produkten echte Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen bieten können. Das umfasst nicht nur Technik, sondern auch Bildung, Community-Building und internationale Zusammenarbeit. Wenn wir das schaffen, haben wir als PI unsere Aufgabe erfüllt.