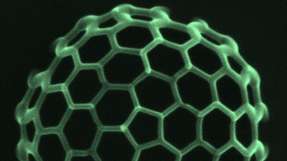Der Traum ist Jahrzehnte alt: Der Designer füttert eine Maschine mit digitalen Daten eines Bauteils, drückt auf einen Knopf und hält nach wenigen Minuten das fertige Produkt in Händen. Die Wirklichkeit hat die Vision inzwischen eingeholt: Im Elektromarkt liegen preiswerte 3D-Drucker für jedermann, die kleine Plastikteile ausspucken. In der Industrie sprechen die Experten von additiver Bauweise, weil die Bauteile nicht durch Fräsen, Sägen oder Bohren aus einem Block herausgearbeitet werden, sondern Schicht für Schicht aus Pulvern, Flüssigkeiten und Kunststoffschnüren, sogenannten Filamenten, entstehen.
Inzwischen gibt es viele unterschiedliche Verfahren, die vor kaum noch einem Material Halt machen. Bauteile lassen sich aus Kunststoff, Metall oder Keramik drucken. Die Liste wird mit jedem Tag länger. Sie reicht von passgenauen Brillengläsern aus Kunststoff über Einspritzdüsen für Flugzeugtriebwerke und Zylinderköpfe für Formel-1-Boliden bis zu Knochenprothesen aus Titan. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat zum Beispiel zusammen mit Festo einen bionischen Handling-Assistenten entwickelt, der einem Elefantenrüssel nachempfunden ist. Diese Entwicklung wurde mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet. Ohne 3D-Druck wäre diese Leistung nicht möglich gewesen. Denn der Handling-Assistent beruht auf einer von Fraunhofer patentierten Aktorik, die nur additiv hergestellt werden kann.
Vorteile additiver Verfahren
Die additive Bauweise hat mehrere Vorteile: Sie benötigt keine aufwendigen Formen oder Werkzeuge mehr, es genügt allein der digitale Datensatz. Das kann Geld und Zeit sparen. Zudem lassen sich komplexe Geometrien erzeugen, die mit herkömmlichen abtragenden Verfahren undenkbar wären. Viele Unternehmen können damit künftig ihre Ersatzteillager abspecken. Tausende Teile über Jahrzehnte vorrätig zu halten, wird nicht mehr notwendig sein.
Für die Verarbeitung von Keramik, ein Werkstoff mit herausragenden Eigenschaften, eröffnet der Drucker zum Beispiel neue Möglichkeiten. Bisher ist die Produktion der Bauteile teuer und aufwendig. „Niemand arbeitet mit Keramik, wenn er nicht unbedingt muss“, sagt Oliver Refle, der für additive Verfahren am IPA verantwortlich ist. Mit der additiven Bauweise lassen sich künftig Prototypen und Kleinserien einfach und kostengünstig realisieren. Sogar fließende Übergänge der Materialeigenschaften wären denkbar. Sie verleihen dem Hochleistungswerkstoff zusätzlichen Nutzen.
Das Fraunhofer IPA beschäftigt sich seit zwei Jahrzehnten mit diesem Thema und ist sich mehr denn je bewusst: Die additive Bauweise hat das Potenzial, Produktionen und Wertschöpfungsketten komplett umzukrempeln. „Unternehmen werden auf Basis der additiven Fertigung in vielen Branchen zu grundlegend neuen Konzepten und Lösungsansätzen kommen. Es braucht dazu aber die Bereitschaft umzudenken – sowohl technisch als auch organisatorisch“, ist sich Oliver Refle sicher. Die Frage ist also nicht, ob diese elegante und platzsparende Methode kommt, sondern wann und in welcher Form.
3D-Druck in Prozessketten
Natürlich gibt es noch technische Herausforderungen. So haben gedruckte Werkstoffe eine andere Struktur und eine andere Oberfläche als gegossene oder gewalzte. Beim Lasersintern mit Metall oder Kunststoff verursacht der Entstehungsprozess eine gewisse Porosität, die weitere Parameter wie Belastbarkeit und Verformbarkeit verändert. Auch ist die erreichbare Maßhaltigkeit nicht bei allen Verfahren den etablierten Fertigungsmethoden ebenbürtig und die Bauteilqualität hängt noch stark vom Fertiger und dessen Know-how ab. Doch diese Kinderkrankheiten bekommen Maschinenhersteller und Forscher immer besser in den Griff. Die Luft- und Raumfahrtindustrie würde nicht zum Drucker greifen, wenn das Resultat nicht akzeptabel wäre.
Eine Hürde für die additive Fertigung ist ihre Integration in einen automatisierten industriellen Fertigungsprozess. Hier gibt es bisher nur wenige erfolgversprechende Ansätze. Bei den heutigen Druckern handelt es sich weitgehend um Stand-alone-Maschinen, die vielfach noch von Hand bedient werden. Doch solange ein Arbeiter jedes fertige Bauteil aus dem Pulverbett puhlen und mühsam reinigen muss, kommt die Technik nicht aus ihrer Nische heraus. Ein Schwerpunkt des Fraunhofer IPA ist deshalb, für die fehlenden Schnittstellen zu sorgen und automatisierte Gesamtprozessketten zu entwickeln.
Auch braucht es automatische Systeme, die das fertige Bauteil aus dem Bauraum greifen. Herkömmliche Lösungen scheitern, weil die Teile ganz unterschiedlich geformt sind. Hier kann ein Trick helfen, den sich die Entwickler vom Fraunhofer IPA haben patentieren lassen: Um das Bauteil herum wird eine Hilfsstruktur mit einer Art Henkel gedruckt. Die unterschiedlichsten Bauteile können so gehandelt werden und sind vor Beschädigung in Nachfolgeprozessen geschützt. Später wird die Struktur einfach weggebrochen oder sie kann sogar noch als Transportschutz weiter verwendet werden. Auch eine automatische Qualitätskontrolle wie bei herkömmlichen Fabrikationsprozessen darf nicht fehlen. Die verringert nicht nur den Ausschuss, sondern verbessert auch den Druckprozess. Noch ist die additive Fertigung vor allem eine Lösung für Einzelstücke und Nischenprodukte.
Hybriden Lösungen gehört die Zukunft
Angefangen hat alles mit dem „Rapid Prototyping“. Diese Anwendung hat sich inzwischen zu einem großen Markt entwickelt, denn für solche Vorserienstücke ist das Drucken konkurrenzlos günstig. In dieser Sparte haben sich Dienstleister etabliert, die bis zu hundert Maschinen in ihren Parks stehen haben. Ein weiterer Markt ist der Sonderanlagenbau, wo letztlich jedes Bauteil ein Einzelstück ist. Viele Kunststoffteile der Anlagen lassen sich inzwischen mit dem Drucker günstiger herstellen als mit herkömmlichen Verfahren. Auch die Medizintechnik ist längst auf den Drucker gekommen, denn bei ihren Produkten handelt es sich meist um Einzelstücke, die im Optimalfall auf den Patienten maßgeschneidert sind. Bei der Massenproduktion kann die additive Fertigung freilich nicht mit den herkömmlichen Prozessen mithalten; dafür dauert der Druck zu lange und die Kosten sind zu hoch. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, obwohl die Kosten und die Bauzeit noch sinken werden. Kleinserien lohnen sich teilweise schon heute.
Dass die additive Fertigung auf dem Vormarsch ist, zeigt auch der Blick auf Unternehmen, die sich damit befassen. Haben sich in diesem Metier bisher nur kleinere Unternehmen getummelt, sind im vergangenen Jahr auch Konzerne eingestiegen. Vor allem im Flugzeugbau, wo der Preis nicht höchste Priorität hat, wird immer mehr additiv gefertigt. In Zukunft wird es aber nicht nur ein Entweder-Oder geben. Es ist zu erwarten, dass sich die additive und die konventionelle Technik gegenseitig ergänzen. Schon jetzt arbeitet das IPA an hybriden Lösungen, die alte und neue Verfahren zu einer pfiffigen Einheit kombinieren. Die Stärken der jeweiligen Technik ergänzen sich dabei und eröffnen so ganz neue Möglichkeiten.