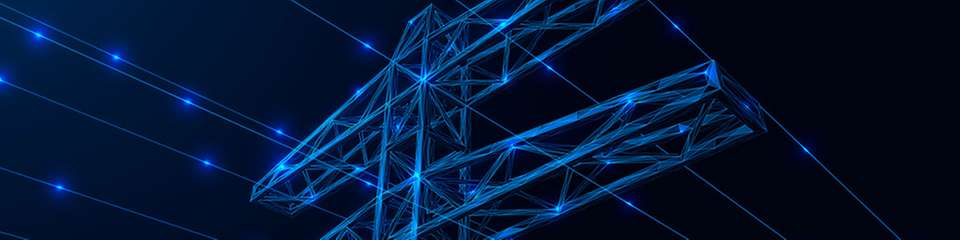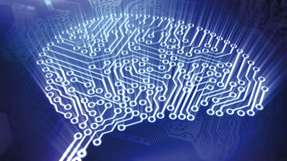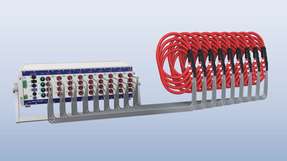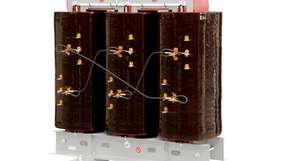Energy 2.0: Herr Prof. Brauner, wenn man Ihre Studie liest, überrascht ein wenig die Aussage, dass die vorhandenen Kapazitäten ausreichen. Braucht es also gar keine Neubauten?
Prof. Dr. Günther Brauner: Akut haben wir die Problemstellung, dass sehr schnell sehr viel regenerative Energie ins Netz kommt. Neue Kraftwerke sind jedoch nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu errichten. Die neuen Dienstleistungsaufgaben, die fossile Kraftwerke leisten sollen, werden am freien Markt noch nicht honoriert. Deswegen besteht die einzige Möglichkeit darin, die Kraftwerke, die wir heute haben, flexibel zu betreiben.
Wie flexibel muss das Kraftwerk der Zukunft denn sein?
Wir haben das Problem, dass 2020 nicht ausreichend Regelleistung vorhanden sein wird, um die starken Schwankungen auszugleichen, die bei einem Anteil von 40 Prozent erneuerbarer Energie entstehen werden. Wir reden von möglichen Leistungsänderungen von bis zu 15 Gigawatt innerhalb einer Stunde, die ausgeregelt werden müssen. Falls mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit noch größere Gradienten auftreten, ist es wirtschaftlich günstiger, die Erneuerbaren vorübergehend abzuschalten. Solche selten genutzten Reserven vorzuhalten, wird zu teuer.
Damit definieren Sie ja auch eine Obergrenze an Erneuerbaren, die wir uns leisten können.
Es ist zunächst sehr wichtig, dass wir Energie dort nutzen, wo sie entsteht - also beispielsweise die Photovoltaik auf Siedlungsdächern. Überschüssigen Strom kann man in Form von Wärme speichern, auch wenn die Wirkungsgrade nicht optimal sind. Als Langfriststrategie eröffnet die Methanisierung von regenerativ erzeugtem Wasserstoff neue Wege. Wenn man Solarstrom in Methan umwandelt, speichert man immerhin 25Prozent der Energie, das ist um den Faktor 250 besser als der Photosynthese-Wirkungsgrad bei Biomasse.
Allerdings sinkt der Wirkungsgrad noch einmal um die Hälfte, wenn man Ökomethan wieder im Gaskraftwerk verbrennt.
Ja, aber es ist trotzdem ein sauberer Prozess ohne Verbrennungsrückstände. Und koppelt man die Wärme aus, erreicht man bis zu 80 Prozent Wirkungsgrad. Unser Problem wird nicht die Erzeugung sein, hier kommen wir bei der Photovoltaik bald auf Kosten von einem Euro je Watt Spitzenleistung. Gravierend ist das Problem der Überschussenergie: Die Sonne geht fast gleichzeitig über allen Kollektoren auf und unter.
Um die Schwankungen auszugleichen, wird der Neubau von Gaskraftwerken vehement gefordert. Können Kohlekraftwerke das nicht leisten?
Die Kohlekraftwerke sind besser als ihr Ruf. Sie wurden in der Vergangenheit zwar als Grundlastkraftwerke eingesetzt, doch sie sind durchaus flexibel einzusetzen. Moderne Anlagen schaffen Gradienten von bis zu sechs Prozent ihrer Nennleistung pro Minute, gegenüber acht Prozent bei GuD-Kraftwerken. Allerdings sind die CO 2-Emissionen zwei- bis dreimal so hoch. Die Frage ist, wie man das gewichtet. Wenn die Anlagen nur noch sehr kurzzeitig im Betrieb sind, für 1500 Vollaststunden im Jahr, dann ersetzen wir heutige 5000 bis 6000 Volllaststunden emissionsfrei durch regenerative Energie. Und nicht zu vergessen: Kohlekraftwerke sind eine Rückfallebene, falls wir eine Gaskrise bekommen.
Bei Teillastbetrieb sinken allerdings die Wirkungsgrade.
Stimmt, der Wirkungsgrad geht bei Gastkraftwerken von 60 bis auf etwa 52, bei Kohlekraftwerken von 45 auf 39 Prozent zurück - aber nicht so dramatisch, wie man immer denkt. Hier kann man allerdings technologisch noch etwas machen, denn die Kraftwerke sind heute für stationären Betrieb im Bestpunkt ausgelegt.
Was sollte dazu passieren?
Vielleicht muss man davon Abstand nehmen, die Kraftwerke bei möglichst hoher Temperatur zu betreiben. Für die hohen Dampfdrücke benötigt man beispielsweise besonders dicke Rohrleitungen, die sich nur langsam erwärmen und daher ein träges Regelverhalten haben - wir brauchen aber Flexibilität.
Das heißt, es ergibt gar keinen Sinn mehr, auf das thermodynamische Optimum hinzuarbeiten?
Man wird immer mehr fossile Kraftwerke als Regelkraftwerke betreiben, sie also mit einer Mindestlast fahren und dann rasch hochfahren. Auf diesen Betrieb hin muss man den Wirkungsgrad optimieren. Unsere Studie zeigt, dass die bestehenden Kraftwerke umgerüstet werden können. Eine wichtige Rolle spielen dabei Leitsysteme, die so herauf- oder herunterregeln, dass die Bauteile maximal belastet, aber nicht zerstört werden.
Fossile Kraftwerke stabilisieren über die rotierende Masse die Frequenzregelung und über die Blindleistung die Übertragungsfähigkeit des gesamten Netzes. Wie soll das mit immer mehr Erneuerbaren künftig funktionieren?
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, rotierende Massen im Netz zu behalten, um die Frequenzregelung stabil zu halten - also auch Generatoren ohne Dampfturbine. Damit bleiben immerhin 30 Prozent der Schwungmasse erhalten. Oder man könnte die Generatoren einschließlich Dampfturbine - ohne Schaufeln - im Netz belassen. Schließlich sind die Netze um die großen Kernkraftwerke herum gebaut. Für eine Übergangszeit gäbe dies viel Stabilität. Weiterhin können die Generatoren (ohne Dampfturbine) Blindleistung erzeugen und damit die Spannung und die Übertragungsfähigkeit des Netzes verbessern.
Aber gibt das die Gesetzeslage her?
Ich meine ja, es handelt sich ja nicht um einen nuklearen Prozess. Biblis A beispielsweise wird so umgebaut.
Wird es mit der geforderten Flexibilität schwieriger, weil unwirtschaftlicher, Kraft-Wärme-Kopplung zu realisieren?
Es gibt auch hier Lösungen. Beispielsweise, indem man ehemalige Öltanks in den Kraftwerken thermisch isoliert und zu riesigen Warmwasserspeichern umfunktioniert. Langfristig interessant sind vor allem energieaktive Häuser, bei denen die Wärmepumpen bivalent betrieben werden können.
In Ihrer Studie betrachten Sie den Zeitraum bis 2020. Aber was kommt danach?
Viele der theoretischen Möglichkeiten, die nach 2020 bestehen, sind noch mit Unsicherheit behaftet: Wie schnell setzen sich Smart Grids durch? Sind viele Elektroautos auf dem Markt, die eine Speicherfunktion übernehmen können? Wir dürfen aber mit der Energiewende nicht warten, bis wir dies alles wissen.
Sie plädieren also dafür, das Akute und das Langfristige nicht zu vermischen?
Ja. Wir haben zunächst einmal von den heutigen Möglichkeiten aus gedacht, um möglichst einen großen Teil der Investitionen in die Infrastruktur weiter verwenden zu können. Das spricht nicht dagegen, in nachfolgenden Studien von 2050 aus rückwärts zu denken und damit den langfristig wirtschaftlichsten und ökologisch günstigsten Weg zu finden.
Denken Sie mal rückwärts.
Wir haben gerade ein Forschungsprojekt zur autonomen, regenerativen und dezentralen Siedlung gemacht: eine Experimentalsiedlung ohne Netzanschluss, die mit regenerativen Energieträgern auskommen muss. Da kommt beispielsweise heraus, dass man, um 95 Prozent Versorgungssicherheit zu bekommen, ungefähr 180 Prozent der Energie erzeugen muss, also 80 Prozent nicht nutzen kann. In einer anderen Untersuchung konnten wir zeigen, dass bei der Sanierung einer Siedlung zwei Drittel des fossilen Primärenergiebedarfes eingespart werden können, aber der Strombedarf um den Faktor 1,5 steigt.
In Summe spricht das für mehr Vernetzung, nicht für weniger.
Wir müssen die Netze ausbauen, wenn wir fossile Energieträger durch Strom ersetzen wollen.
In Ihrer Studie gehen Sie aber davon aus, dass Deutschland eine Strominsel ist. In der Realität wird ein Teil des Puffers doch in Strom bestehen, den wir aus dem europäischen Netzverbund ziehen.
Die Übertragungsnetze, die wir heute haben, besitzen eine lokale Übertragungskapazität von 15 bis 20 Gigawatt. Das heißt, wir können nicht deutlich mehr über die Grenzen schieben, als wir dies heute schon tun. Verglichen mit der zukünftigen installierten regenerativen Leistung ist das nichts.
Ein europäischer Netzverbund auf Basis der Hochspannungs-Gleichstromübertragung ist also keine gute Idee?
Das Grundsatzproblem ist das gleiche wie bei Desertec: Die Anrainerstaaten werden einen Teil des Stroms für sich beanspruchen. Wir haben daher gesagt, wenn Europa regenerativ wird, dann muss jede Region zunächst für sich selbst bilanzieren. Das ist die preiswerteste Infrastruktur, zudem bestehen dann keine Abhängigkeiten von anderen. Das gilt insbesondere, wenn wir eine Energiewende initialisieren, die die Nachbarn in dieser Dramatik nicht mitmachen. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass wir mit dezentraler Technik auch eine weltweite Vorreiterrolle einnehmen können. 25 Prozent der Menschheit leben ohne Zugang zu Strom, die beginnen alle dezentral.
Hinter Ihrer Studie stehen Windenergie-Forscher und Betreiber fossiler Kraftwerke. Wie haben Sie da Einigkeit erzielt?
Mit der Wiener Methode.
Die müssen Sie uns erläutern!
Die Wiener Methode besteht darin, gemeinsam zum Heurigen zu gehen und so das Misstrauen abzubauen. Am Tag darauf kann man dann sehr sachlich diskutieren.
Das Gespräch führte Johannes Winterhagen, Energy 2.0